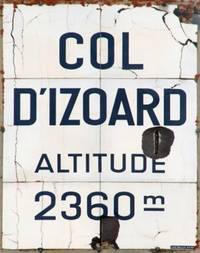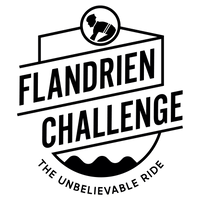Diese Seite wird noch erstellt.
Schönen guten Tach und willkommen auf meiner Tagebuchseite.
Tagebuch? Andere nennen es Blog, ich bin altmodisch, für mich bleibt es ein Tagebuch. Ich fahre gern Rad. Ich schreibe gern. Also schreibe ich jetzt übers Radfahren, so hatte es irgendwann mal angefangen. Mit ein paar geschriebenen Zeilen in einem kleinen Buch über eine absolvierte Tour. Jeder kennt diese Momente, die man nicht loslassen oder verfliegen lassen möchte. Alles wird tief aufgesogen und geradezu inhaliert. Egal ob es sich um eine Situation oder ein Gefühl handelt - der Zauber des Augenblicks ist kostbar und will bewahrt werden. Oder wie bei einem Junkie – immer und immer wieder erlebt werden. Ich bin manchmal selbst überrascht, wie viele unvergesslich schöne Momente mir das Rennradfahren in kürzester Zeit beschert hat.
Arthur Schnitzler schrieb mal:
„Am Ende gilt doch nur, was wir getan und nicht, was wir ersehnt haben.“
Genau darum geht es. Nicht träumen, sondern einfach machen. Je mehr man aber erlebt hat, je höher die Ziele sind, je schneller verblasst aber auch die Erinnerung. Kennt Ihr das auch? Könnt Ihr Euch auch gar nicht mehr so wirklich an all die vielen Anstiege und schönen Touren erinnern? Und auch nicht so wirklich detailliert an die Abfahrten? Habt Ihr auch nur noch so kleine Fetzen, Filmausschnitte oder Slogans wie "Arlberg? Sehr steil! Aber mehr weiß ich nicht mehr ..." im Kopf? Kennt Ihr das nicht? Mir ging es so…
Damit man sich an die schönsten Stunden im Sattel auch nach Jahren noch erinnert, habe ich angefangen, diese Erlebnisse zu Papier zu bringen. Nach und nach wurden es mehr. Mehr Touren, mehr Erlebnisse, mehr Zeilen. Daraus entstanden kleine Geschichten und diese wurden dann mit Fotos unterlegt. Und schließlich entstanden daraus meine Bücher und nun diese Website. Schon krass, wie sich das alles entwickelt hat.
Und somit habt ihr hier nun die Möglichkeit, kleine Geschichten von meinen Erlebnissen, Abenteuern und Unternehmungen zu lesen, die es (noch) nicht in ein Buch geschafft haben. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden...
Den Anfang macht - ganz aktuell - ein tolles Erlebnis aus dem letzten Urlaub.
Ein bisschen Tour de France – unser Sommermärchen 2023
Sind wir nicht alle vom täglichen Alltag einfach mal ausgelaugt und sehnen uns nach einer Möglichkeit richtig aufzutanken? Mal wieder so richtig Urlaub machen? Sonne, Wärme, Berge, Ruhe und Natur. So sieht ein perfekter Urlaub aus. Wirklich? Naja, fast, denn etwas wichtiges fehlt in der Aufzählung.
Richtig! Das Rad 😊.
Also galt es ein lohnendes Ziel zu finden. Eines, dass Sonne, Wärme, Berge, Ruhe und Natur mit dem Rad möglich machte. Mit dem Finger auf der Landkarte suchte ich herum. Niederlande, Belgien, Österreich, Italien, Frankreich…die Wahl fiel (wieder mal) auf die französischen Seealpen. Und in mir stieg wieder diese unbändige Vorfreude auf.
Berge sind im Radsport zweifelsohne das Salz in der Suppe. Hier bekommt man den Kopf frei. Ohne eine andere Menschenseele fährt man Höhenmeter für Höhenmeter und hat die Möglichkeit die Seele baumeln zu lassen. Von den Namen der Profis in den Kehren der Alpe d’Huez bis zu den Denkmälern für Fausto Coppi und Louison Bobet am Col d’Izoard – in den Alpen konnten wir Radsportgeschichte hautnah erleben. Fünf Etappen, hinauf zu den legendären Pässen. L`Alpe d`Huez, Col du Granon, Col d`Izoard. Col du Galibier…das wurde unser Sommermärchen 2023.
Unser?
Ja, denn natürlich hat Marc mich begleitet und so wurde es ein epischer Bestfriendsride durch die Alpen. Ich hoffte auf schönes Wetter. Ich wünschte mir blauen Himmel. Und Wärme. Es wurde noch besser, es wurde ein absoluter Traum. Am Ende hatten wir so viele Eindrücke im Kopf, so viel Endorphin-geschwängerte Momente, die in Zeitlupe erstarren, in stundenlangen Anstiegen auf geheiligtem Asphalt, so viele Abfahrten, die alles in den Schatten stellten, so viele "Aaahs" und "Oh-la-las", dass es Wochen dauern wird, das alles zu verarbeiten. Ein genialer Trip. Wir beide, wie Gott in Frankreich. Ein Lebenstraum. Und dabei haben wir gelacht und gelitten, gebummelt und gebolzt, geheult und gebrüllt. Eine Männertour, mit Blut, Schweiß und Tränen, mit Salz auf den Lippen und Öl an den Händen. Aber mal der Reihe nach.
Unsere Basis war in Briançon, dass ich noch von meiner Reise 2019 kannte. Damals war ich schon einmal hier gewesen und die berühmten Berge der Tour de France gefahren. Das war so überwältigend, so unwirklich, so phänomenal und vor allem viel zu schnell vorbei, sodass ich es unbedingt nochmal machen wollte. Einfach so, ohne Bestzeitenjagd, ohne Druck. Einfach nur zum Genießen. Hier ist es viel zu schön, viel zu atemberaubend, viel zu einmalig, als es im wilden Blindflug bei Maximalspeed links liegen zu lassen. Hier, das weiß ich, werde ich so schnell bestimmt nicht wieder herkommen können. Also lieber mal den Kopf hoch nehmen und Genießer-Modus anschalten.
Diese kleine schnuckelige Stadt wirbt mit dem Slogan, die höchstgelegene Stadt Frankreichs, wenn nicht gar Europas zu sein. Und die von der Tour de France bekannten Pässe sind alle nur einen Steinwurf entfernt. Völlig fasziniert, fast wie in einem Film, so starre ich auf der Hinfahrt aus dem Auto heraus auf die Berge. Sie wachsen und wachsen. Senkrechte Wände erheben sich neben mir. Schroffe, brutale, graue, grandiose Wände. Schnee prangt auf ihnen, Sie ziehen sich von ganz rechts vor mir hinweg bis ganz links. Bombastisch, gewaltig, atemberaubend schön. Und ich, ich sehe nur einen Teil. Nicht mal die höchsten Berge sind das hier. Und gerade das macht sie noch größer. Dort steht schon der Abbiegehinweis zum Col du Galibier. Jubeln, soll ich jubeln? Oder wenigstens grinsen? Mich freuen? Oder in Ehrfurcht erstarren? Zweifelnd, freudig, ängstlich, neugierig - ich bade in Gefühl. Und dabei sitzen wir noch im Auto und rollen über die Autobahn…
Dann aber, nach knapp 14 Stunden Autofahrt waren wir endlich da, bezogen unser kleines Ferienappartement und freuten uns auf eine Woche „leicht hügelig bergauf“ 😊. Wir konnten es kaum erwarten… Alles war angerichtet, ich war on Fire und das Abenteuer konnte beginnen!
Col du Lautaret und Col du Galibier
Der nächste Morgen.
Yeah! Heute geht’s aufs Rad! Ich wache auf und bin sofort auf 180. Grinse schon, ohne, dass ich überhaupt einmal aufgestanden wäre. Denn heute, heute ist the Day - heute fahren wir unsere erste Etappe! Es ist ein wunderbarer Morgen. Perfekt. Herrlich. Anders hätte ich es auch nicht erwartet, denn an einem Tag wie diesem, an dem ein Traum in Erfüllung geht, muss einfach alles stimmen: Wetter, Laune, Beine.
Heute starten wir unsere Tour de France. Die Berge: ab heute werden wir sie erobern.
Marc und ich stehen sehr früh auf - bereits um 8 Uhr haben wir gefrühstückt, haben wir uns dick mit Sonnencreme eingeschmiert und stehen fertig angekleidet vor unserer Ferienwohnung - bereit für die erste Etappe. Wir sind guter Dinge als es gegen neun Uhr auf die Straße geht - es ist warm, der Himmel nicht bewölkt. Gerade so, als wollten uns die Col´s von ihrer besten Seite begrüßen. Das Abenteuer kann beginnen. Und es wird ein ganz besonderer erster Tag. Wie wird es sein? Was wird der Tag bringen? Fragen, die wir gestern beim Abendessen noch so intensiv diskutiert haben, sie sind jetzt belanglos. Jetzt fahren wir los. Adrenalin zirkuliert in meinen Adern, als wir unser Startfoto machen. Wir klicken ein. Schieben die Räder an. Rollen los. Unser Sommermärchen beginnt mit einem Paukenschlag. Es geht direkt aufs Dach unserer Tour, den höchsten Berg der Reise, den Col du Galibier.
Es gibt Berge, bei denen allein der Name ausreicht, um als Rennradfahrer in Ehrfurcht zu erstarren. Berge, bei denen man direkt Bilder im Kopf hat. Für mich ist so ein Berg der Col du Galibier. Erster Alpenpass in der Geschichte der Tour de France – diese Auszeichnung gehört dem Galibier. Es mag zwar einige – wenn auch nur wenige – höhere Gipfel geben, aber das 2.650 Meter hohe Urgestein ist ein Mythos, wer ihn bezwingt ein Meister. Col du Galibier - welch ein Leckerbissen der Tour-Geschichte, der heute auf uns wartet. Mit seiner Passhöhe ist der Galibier der fünfthöchste Straßenpass der Alpen und natürlich bereits einige Male das Dach der Tour de France gewesen. Und wer auf den Galibier will, der muss von Briançon aus zuerst noch den Col du Lautaret bewältigen - im Grunde erwarten uns heute also zwei Pässe, um auf den höchsten Punkt unserer Reise zu kommen.
„Jeder, der es schafft, auf den gleichen mythischen Anstiegen und unter den gleichen Bedingungen wie die Profis dort oben anzukommen, ist eine Legende“, sagt Christian Prudhomme, der „Tour“-Direktor.
Aus Briançon heraus ist wenig Verkehr. Rückenwind und Gegenwind wechseln sich eigenartigerweise ab. Ab und an überlagert beißender Gummigeruch all die feinen Blumen- und Kräutergerüche. Er stammt von Wohnmobilen, Autos und Motorrädern, die auf der anderen Straßenseite mit heißen Bremsen dem Tal entgegen rattern. So riechen also 30 Kilometer Abfahrt. Aber wie schmecken wohl 30 Kilometer Auffahrt mit dem Rennrad? Wir sind dabei das herauszufinden.
Die Temperatur steigt unaufhaltsam. Keine 5 Kilometer gefahren und schon steht Schweiß unter meinem Helm. Die Fahrbahn ist in einem sehr guten Zustand. Fröhlich quatschend cruisen wir dahin.
Das sind nun also die französischen Alpen. Schroffe Felsen, nur spärlich bewachsen. Karge Büsche, die dem bisschen trockenen Sand auf den harschen Felsen das bisschen Leben entlocken. Vögel kreisen und zwitschern, die Sonne knallt unerbittlich. Unter mir surrt die perfekt eingestellte Dura Ace ihr Lied und ich muss daran denken, wie sie hier alle durchgekommen sind: Roglic, Pogacar, van Aert und all die anderen. Es sind Straßen wie diese, die die Geschichte eines so faszinierenden Sports atmen, derer wegen wir hier sind - es ist das Gefühl, diesen Legenden zumindest nachvollziehbar zu folgen, das dieses glückliche Grinsen auf unsere Gesichter zaubert. Und natürlich diese Landschaft, diese wunderschönen Berge hier ringsherum. Es läuft gut. Sehr gut sogar. Ich fühle mich prächtig. Auch die die Hitze macht mir - vorerst - nichts aus. Ich habe es sowieso gern lieber heiß als kalt. Immer grandioser wird das Panorama. Die Straße ist sehr breit und steigt von Briançon bis zum Pass mit nur einer einzigen Kehre an. Mit einer angenehmen Steigung von ca. 3-5% geht es mit toller Aussicht auf die Dauphine zügig die 26 Kilometer und 800 Höhenmeter hinauf zum Col du Lautaret. Die Steigung, obschon nicht wirklich hart, ist nun deutlich zu spüren: Die ersten 500 Höhenmeter sind längst schon gemacht und mit jedem weiteren Kilometer kommen sie Meter um Meter hinzu.
Stolze 2.058 Meter ist der höchste Punkt des Col du Lautaret hoch. Von hier aus scheinen die schneebedeckten Gipfel der umliegenden Berge nur einen Steinwurf entfernt zu sein. Ich atme durch, genieße die Leere.
Ein richtiger „Rollerberg“. Immer seicht ansteigend und nicht zu steil. Ein schöner Aufgalopp, denn dieser Pass ist heute nur das Zwischenziel. Nach 1 ½ Stunden stehen wir oben in der Sonne und ich leere meine erste Trinkflasche. Es herrscht eine Backofenhitze. Es ist nun kurz nach 10 und hier oben sind es knapp 30 Grad. Wir sehen uns um. Vor aus baut sich der Galibier auf. In all seiner Größe, in all seiner Faszination. Ich sehe die Masse des Berges, etliche Kurven, die schmale Straße, die bergan führt. Beim bloßen Anblick spüre ich schon die Schmerzen, die mich gleich erwarten werden. Rechts biegt die Straße zum Col ab. Geil! Noch mal 500 Höhenmeter! 8 Kilometer sind es noch bis zum Gipfel. Hatte ich schon erwähnt, dass es auch heute wieder schweineheiß ist? Herrlich. Die Salzkristalle glitzern auf der Haut.
Gleich hinter der Abbiegung steht es mächtig drohend da: Das Schild.
Col du Galibier.
Geöffnet.
Übergroß.
Am Ziel so vieler Träume: Was habe ich nicht alles über diesen Pass gelesen? Welche Dramen haben sich hier abgespielt, welche Siege sind hier gefeiert worden und welche Niederlagen sind hier zu ertragen gewesen? Ein Wort, ein Klang, in meinen Ohren so fesselnd: Galibier.
Der Berg ist "Hors Categorie", ein Begriff, der die Radprofis bei der Tour de France aufstöhnen lässt, wenn er im Streckenplan auftaucht. Dort thront das gefürchtete "HC" nämlich über den besonders krass gezackten Spitzen im Höhenprofil einer Bergetappe – und bezeichnet die höchste von fünf Schwierigkeitsstufen bei der Klassifizierung der Anstiege. Wörtlich übersetzt heißt "Hors" etwa so viel wie "außerhalb". Vielleicht außerhalb des Normalen? Oder jenseits von Gut und Böse? Das schwerste vom Schwersten also. Na dann, Helm ab zum Gebet ... und so willige ich wohlwollend ein, mich und mein Rennrad die Serpentinen hinauf zu kurbeln - kein leichtes Unterfangen bei 30 Grad im Schatten - und von Schatten ist weit und breit nichts zu sehen. So gehe ich in die Vertikale, schalte auf das kleine Kettenblatt und trete so gleichmäßig wie ich kann die Steigung ab. Es geht Meter um Meter höher. Es ist hier noch nicht so steil, dass es einen gleich killt, aber, so befürchte ich, der Berg wird erst noch sein wahres Gesicht zeigen. Links neben mir türmt er sich auf. Um seine Spitze sehen zu können, muss ich meinen Kopf bis ganz in den Nacken legen - was kurzzeitig meinem Balancegefühl schadet und ich zu schlingern beginne. Dann lasse ich das lieber mal - in einer Stunde bin ich eh da oben, denke ich und kurbele weiter.
Der Galibier ist auch deshalb Hors Categorie, weil er eine ganz feine Überraschung für die Sportler, die ihn bezwingen wollen, parat hat. Seine Steilheit nimmt mit jedem Höhenmeter zu.
Es geht bergauf. Wieder mal. Die Steigung jetzt: direkt mal 10%. Doch der Galibier ist nicht nur ein Radsport-Klassiker, der mit ordentlich Tour-de-France-Flair aufwarten kann, sondern auch ein absoluter landschaftlicher Leckerbissen. Um mich herum: grüne Wiesen. Voraus: die schroffen, grauen Felsen. Manchmal habe ich das Gefühl, als fahren wir direkt in den Himmel. Ich höre wieder mal nichts. Außer meinem eigenen Atmen und dem Surren der Kette. Ansonsten ist es um mich herum vollkommen still. Immer wieder fesselt mich der Ausblick. Wahrlich erhebend. Nichts trübt die Sicht - da sieht man mal wirklich, was 2.000 Meter Höhe sind. Grandiose Berglandschaft, kaum ein Auto, kaum ein Motorrad, wolkenloser Himmel – ein Traum.
Man mag es sich kaum ausmalen, wie es während der Tour de France hier abgeht. Vor allem, was die Fahrer hier leisten müssen. Wir, wir Hobbyradler, sind froh, wenn wir die Strecke zum Pass in einer Stunde schaffen. Die Profis stürmen doppelt so schnell hier den Berg hinauf - mit 20, 25 km/h, viel im Sitzen, erst ganz zum Schluss, ihre Gegner taxierend, gehen sie aus dem Sattel und sprinten in der Vertikalen davon. Wahnsinn. Im Schnitt geht es hier mit 7,4% Steigung bergan. Aber Schnitte, das haben wir schon so oft bemerkt, sind kein Indikator. Für gar nichts. Da hatten wir schon an 6%-Bergen ein paar Rampen serviert bekommen, dass es nur so gescheppert hat im Kniegelenk. Aber hilft ja nix, wer was sehen will, muss treten. Diese Steilheit ist der helle Wahnsinn! Es mögen allein in diesem Teilabschnitt deutlich über 10% Steigung sein. Fuck! Die Waden brennen! Hitze steigt in mir auf, der Schweiß läuft in Sturzbächen und jedes Mal, wenn ich meine Hände zu Fäusten balle, presst es Wasser aus meinen vollgesogenen Handschuhen. Ich triefe mich den Anstieg hinauf. Ich hinterlasse eine Tropfspur aus Schweiß.
Wenn ich meinen Kopf hebe, sehe ich hohe und kahle Berge rings um mich herum und ein graues Band, dass immer mehr ansteigt. Steigt und steigt. Schaue ich nach unten, sehe ich glänzende Waden, angespannte Sehnen und Muskeln, schweißbedeckte Stränge, die sich mühen, eine Kurbel zu drehen. Ich kurbele wie in Zeitlupe. 11 km/h. Zum gefühlt hundertsten Mal heute wuchte ich mich im Wiegetritt nach oben. Weit hinter mir kann ich Marc erkennen.
Superzeitlupe.
Wir nähern uns dem Gipfel. Ich versuche, alle Eindrücke aufzusaugen. Wenn ich den Kopf nach rechts drehe, dann sehe ich eine Traumkulisse. Ein wundervoller Anblick: Drüben die anderen Berge. Schneebedeckte Gipfel. Darüber azurblauer Himmel. Ein Genuss.
Am Tunnel vorbei geht’s in die finalen Kehren. Die letzte Kurve und das folgende Steilstück fliege ich förmlich nach oben. Col du Galibier. Das stehts, schwarz auf weiß. Ich passiere das Schild. Es adelt mich. Und meine Waden. Ich stoße einen Schrei aus: Marc soll ruhig hören, dass ich schon oben bin. Wo mag der noch strampeln? 2 Minuten Vorsprung? 5 Minuten oder gar 10? Ich warte ein paar Minuten, da kommt er schon. Kurz nach mir. Geil! Geschafft! Ich jubele ihm zu - kann mich mit ihm für ihn freuen. Auch er lehnt sein Rad an die Wand. Hält erstmal inne. Nimmt lange Schlucke aus der fast leeren Wasserflasche. In seinen Ohren wird es genauso klingeln, wie in meinen. Vielleicht klingelt da gerade unsere Hymne, als wir uns in die Arme fallen und uns beglückwünschen. Ehrliche Freude. Wir sind ein cooles Team.
Zwei Jungs, die eine Tour machen. Zwei Jungs, die dieselben Ziele haben. Zwei Jungs, die einen der legendärsten, einen der härtesten, einen der schönsten Pässe der Tour de France geschafft haben!
Wir klatschen ab.
"Yeah, erster Berg, Digger!".
Geschafft: Oben! Nur noch nackter Fels trennt uns vom Himmel. Unter uns nichts als Höhenmeter. Mit stolzgeschwellter Brust stehen wir in der Sonne und genießen diese unfassbare Aussicht. Wir stehen einfach nur da und starren in den Abgrund. Dieser Berg ist etwas ganz Besonderes. In vielerlei Hinsicht. Hier kann man sich so richtig schön wehtun – so wie wir Radfahrer das eben gerne machen. Wir schweigen, denn dieser Blick lässt uns verstummen. Ein Moment der Ehrfurcht, der uns daran erinnert, dass es genau diese Straßen sind, die wir fahren wollen. Diese imposante Kulisse, diese wilde Schönheit. Wir stehen hier auf dem Gipfel, mit klopfenden Herzen, keuchendem Atem und einer tiefen Zufriedenheit.
Viele Rennradler tummeln sich hier, ein Stopp and Go, immer wieder Motorradfahrer, aber ich will erst einmal meine Ruhe. Stehe da. Schaue. Eine Minute. 5 Minuten. Dann gehe ich zur Rampe. Wow, wie steil das hier abgeht! Erst jetzt sehe ich, was 10% Steigung wirklich sind - nämlich verdammt steil! Wie eine Eisenbahnplatte sieht es aus, wie im Wunderland - saubere, heile Welt. Perfekte Kulisse, um sich die Probleme und Sorgen unseres Planeten wegzuträumen. Abschalten, wegfliegen. Alles ist so schön hier, so herrlich anzusehen. Endlich verstehe ich, warum sie alle so begeistert sind von diesem Land, von seiner Schönheit, dieser Wildnis - dieser Natur. Ich sehe die Serpentinen. Da ganz tief unten. Ich stehe vor einer Fotoleinwand. Ferne Wildnis, gezähmt nur durch eine einfache, einsame Straße. Panorama der Kraft. Da unten. Da unten war ich gerade. Da unten. Und da werde ich gleich wieder sein.
Wir stürzen uns in die Abfahrt.
Schnell erreichen wir über 60 km/h auf der ersten, beinahe schnurgeraden Rampe. Es ist bei jeder einzelnen Abfahrt so faszinierend, nach unten zu kommen. Immer dasselbe Ritual, immer dieselben Vorgänge. Noch weit, weit oben sind es knackige, kurze Serpentinen. Sehr steile Abhänge, die einen in kürzester Zeit beschleunigen, wenn man die Bremse loslässt. Je tiefer man kommt - oder besser, je mehr man wieder in die Zivilisation eintaucht - desto weniger Kurven gibt es, die Serpentinen gehen in längere, sich seicht in den Hang schlängelnde Geradeausstücke über, die zwar weniger steil sind, dafür aber sehr viel schneller gefahren werden können. Man traut sich nun auch mehr. Bis nah an die 70 km/h komme ich, kauere mich auf mein Rennrad, den Kopf ganz unten - nur ja so wenig wie möglich Luftwiderstand bieten! Noch lange, lange, lange wird es bergab gehen. Schier endlos zieht sich das Tal in die Ferne. Schier endlos können 30 Kilometer Abfahrt sein. Marc und ich lassen es ein paar Kilometer rollen wie die Verrückten. Im Paarflug wie in Star Wars schießen wir als Duo die Flanken des Berges hinab. Ich genieße die Kilometer, sauge jeden Meter in mir auf: Steine, Felsen, Gras, die Berge, der Speed - ein Rausch, ein Genuss, wahrlich. Und dann, um runterzukommen, halten wir an, veranstalten fototaugliche Vorbeifahrten fürs Album. Für unser Ego. Und für die Lieben daheim. Das Grinsen, dass mir diese Passabfahrt ins Gesicht zaubert, wird noch sehr lange anhalten. Nach schier endlosen Minuten im Geschwindigkeitsrausch sind wir im Tal und rollen nun gemütlich in Richtung Briançon. Frohen Mutes trete ich rein - das Wetter, die Straßen - einfach alles ist perfekt an diesem Tag!
Am Abend sitze ich da und schreibe Notizen in mein Tagebuch. Sitze da und schreibe WhatsApp an meine Liebste daheim. Sitze da und massiere meine pulsierenden Waden und quatsche mit Marc. Über unseren Trip, die wundervollen Berge und wie gut es uns doch geht. Zufrieden genießen wir den restlich Tag. Entspannt bummeln wir etwas durch die engen Gassen des malerischen Briançon, suchen und finden ein gemütliches italienisches Lokal. Und dann genießen wir warmes, selbst gebackenes Brot, einen Salat, der unfassbar groß und lecker ist und als Hauptgang eine ordentliche Portion Pasta, die mir heute, da ich dies hier schreibe, noch das Wasser im Munde zusammen laufen lässt.
Was für ein herrlicher Beginn einer wunderschönen Woche!
Col du Granon
Ach, das war schön gestern, denke ich, als mein Handywecker mich aus einem Traum holt. Am allerersten Tag schon direkt zwei Pässe gerockt und heute, heute steht der Col du Granon an. Ich strecke mich, recke mich - fühle in meine Muskeln hinein, versuche, den Beinen einen kleinen Statusbericht abzulocken - und alles ist auf GO!, keine Probleme. Ich fühle mich prima, blinzele in die Sonne, frühstücke mit besonders weit geöffneten Augen. Schaue hinaus. Gegenüber, um mich herum, die Berge. Beeindruckend groß, gnädig gewähren sie der aufgehenden Sonne gerade genug Himmel, um das Tal zu erwärmen.
Early Bird catches the worm ...
Wir kurbeln durch das 10.000-Einwohner-Städtchen der grellen Sonne entgegen. Über uns thront die mächtige Festung von Briançon. Auch aus dem Ort heraus geht es immer leicht bergan, durch ein wunderschön geschwungenes Tal. Links und rechts kann ich schon diese riesigen Berge sehen. Teilweise noch mit Schnee auf den Gipfeln. Wir kommen gut voran. Es ist noch früh, kaum Autos unterwegs, es weht ein leichter Wind von vorn, der aber wenig bremst. Die Sonne steht schon hoch und blendet. Trotzdem: Eine sonderbare Euphorie keimt in mir. Und ich fühle: Der frühe Vogel - also ich - wird heute einen richtig dicken Wurm bekommen! Wir biegen rechts ab in den für heute geplanten Anstieg. Ein herrlicher Anblick. Ich fingere das Handy aus der Trikottasche und mache Fotos.
Merklich zieht die Straße an, ich muss ein, zwei Gänge leichter schalten und schnell stecke ich das Handy wieder zurück ins Trikot. Es geht zum Col du Granon. Selbst Marc scheint langsam aufzutauen. Er lächelt wieder. Er kann grinsen und er wirkt, als wolle er es diesem Berg heute mal so richtig besorgen. Die Straße steigt auf über 11 Kilometern im Schnitt mit 9,2% an und die Passhöhe liegt auf über 2.400 Metern. An diesem Pass entschied sich der Tour-Sieg 2022, als Pogacar einbrach und über 2:50 Minuten verlor. Also ein richtiger Kanten. Das werden wir später noch zu spüren bekommen…
Es ist noch leer - um 9 Uhr sind erst wenige unterwegs - als wir in die erste Rampe gehen. Es geht sofort richtig heftig zur Sache. Die ersten 1,5 Kilometer wartet der Berg mit über 13% auf. Marc fällt schnell zurück, obwohl ich mir heute vornehme, sehr langsam, sehr ruhig die Kehren in Angriff zu nehmen. Trotzdem bin ich schon im roten Bereich. Sofort schießt mir das Laktat in die Beine. Ich fühle mich wie ein Hühnchen im Backofen. Über mir brennt die Sonne, mir schießt der Schweiß aus jeder Pore und bildet einen öligen Film auf der Haut. Ich nehme mich zurück, denn es wird lang, sehr lang und steil, sehr, sehr steil werden. Schweiß tropft auf das Oberrohr und mein Blick geht zu den Viertausendern auf der gegenüberliegenden Seite.
Und was von Weitem schon sehr imposant ausgesehen hat, wird nun alle hundert Meter noch beeindruckender Ich könnte laut schreien, so geil finde ich es hier. Immer wieder muss ich meinen Kopf anstrengend nach oben biegen, um diese Berge zu bestaunen. Die Aussicht ist wirklich phänomenal. Wo ich auch hinsehe, es sind Bilder der Superlative. Es ist einfach herrlich. Die Natur gefällt mir. Weit hinten verschwimmt alles ins Blaue, vor mir, im Hitzeflimmern, wippen müde Nadelbäume in mildem Wind, der durchs tiefe Tal zieht.
Es ist brüllend heiß. Das Trikot schon weit offen, das Unterhemd, das ich unter meinem Trikot trage, ist vollgesogen. Mein Helm hat Abdrücke hinterlassen und meine Handschuhe sind triefend nass. Mir läuft der Schweiß literweise am Körper hinab. Aber hey, dafür sind wir ja hier - mache ich mir Mut und hoffe, dass ich schon bald wieder in meine Fahrradtrance fallen möge.
Alter, ist das heiß! Bullenhitze.
Ich hangle mich weiter, kämpfe mich kleine, aber knackige Rampen hinauf und schaue nach vorn. Nix. Ich drehe mich um. Nix. Kein Auto, keine Motorräder, keine anderen Radfahrer, nichts. Ich bin allein. Es ist absolut still. Fast schon beängstigend. Ich genieße diesen Moment, möchte ihn am liebsten festhalten. Es ist der perfekte Moment. Ich kurbele hier in Zeitlupe in der sengenden Sonne den Berg hinauf, habe ein unfassbar schönes Panorama um mich herum und höre nur mein eigenes Keuchen. Sonst ist wirklich absolute Stille. Alles ist perfekt. Auf jedem Meter sauge ich auf, was die Landschaft hier zu bieten hat.
Laotse, der chinesische Philosoph und sein berühmtes Zitat fallen mir ein: "Die größte Offenbarung ist die Stille."
Irgendwann, wir kennen das ja, irgendwann geht das Hirn aus. Irgendwann übernimmt etwas anderes die Kontrolle. Man selbst geht weg, zieht sich zurück, verlässt seinen Körper und schwebt irgendwo hin. Irgendwo, wo einen die Gedanken gerade hintragen. Wie im Trance, weit, weit weg. Nur nicht hier. Wo der Asphalt dampft, wo meine Schläfen pochen und mein Blut kocht. Wo sich die Straße vor mir auftürmt, wo ich durch eine grüne Hölle kurbele, 8, 9 km/h, gerade mal so. Auf dem letzten Zahn. Aber es hilft. Autogene Flucht. Sie bringt mich diesen Berg hinauf. Bei all meinen bisher erfahrenen Bergen habe ich eins sicher gelernt. Für mich ist es der langsame, der kontrollierte Rhythmus, den es zu finden gibt. Hier, an diesem Abhang und heute, an diesem Tag, gibt es keinen Gegner, den ich besiegen müsste. Hier zählt nur das jetzt und hier.
Manchmal ist der Weg das Ziel. Und das ist gut so. Denn der Weg kann atemberaubend schön sein. Nur, dass es hier richtig giftig nach oben geht und die Kombination aus heißer, stehender Luft, einer die schwitzenden Köpfe stetig umschwirrenden, Nerven raubenden Armada brummender Fliegen und eben jene durchschnittlich 10% Steigung, die einem den Saft aus den Muskeln ziehen. Immer höher geht es hinauf - der Blick zurück offenbart die Höhe, die ich hier mit hochrotem Kopf, kochendem Blut und butterweichen Waden erobere. In meinen Beinen zirkuliert Säure, der Schweiß läuft in Strömen aus meinem Helm und das Laktat tropft mir aus den Ohren - ich möchte nicht wissen, wie meine Augen jetzt aussehen. Unglaublich, unfassbar! Ich stelle mich in einer S-Kurve - keine 50 Meter lang, dafür brutal schwer zu fahren, an die Seite und versuche, ein Foto zu machen, dass diese Brutalität einfangen könnte. Je höher wir kommen, desto klarer wird die Luft, desto öfter möchte ich dem Impuls nachgeben, einfach anzuhalten, mich ins Gras zu setzen, um ein paar Stunden einfach nur dazusitzen, um mir jedes Detail einzuprägen, alles in mir aufzusaugen.
Wo Marc wohl gerade ist? Ah, da kommt er um die Ecke. Gar nicht so weit weg. Es sieht aus, als würde er lächeln…ich lasse ihn herankommen, irgendwie will ich das hier ja nicht allein machen. Ich schieße unzählige Fotos. Langsam kommt er näher, schnauft sich wie immer in einem hohen Gang die Prozente hinauf. Ich grinse ihn an und höre mich sagen: „So schlimm ist das hier ja gar nicht.“
Ich habe es kaum ausgesprochen, da kommt es knüppeldick. Es folgt der Streckenabschnitt, auf dem Pogacar bei der Tour eingebrochen ist. Alle meine radsportlichen Albträume lassen grüßen. Es folgt die Mutter aller Steigungen, das "Bück Dich!" nach der Seife, meine Apokalypse. Der Weg macht eine scharfe Linkskurve und was sich da vor mir auftut, ist nichts geringeres als Asphalt-Terror. Durchgängig über 12% Steigung verspricht mir das Schild. Auf einem Stück Asphalt, das diesen Namen nicht verdient. Quadratmetergroße Löcher, so tief, dass man ganze Fahrräder darin versenken könnte. Und habe nicht mal mehr Zeit zu beten. 12 % Steigung steht auf dem Schild. Naja, rede ich mir ein, das hatten wir schon so oft, da schaffen wir die auch noch. Kleines Blatt. Kleinster Gang. Here i come...
Ich stemme mich mit aller Macht diese Rampe empor und glaube, ich ticke nicht richtig. Atemlos klicke ich nach nur 2 Kehren aus. Meine Lunge muss ich umständlich zurück in meinen Brustkorb stopfen, ich drehe mich um, blicke geschockt in den Abgrund, den sie hier "Straße" nennen und versuche, das Unfassbare zu begreifen. Das hier soll eine ganz normale Straße sein? Wer baut sowas? Und warum? Unzählige Flüche, gefühlte dreihundert Höhenmeter und etwa drei Liter Schweiß später rette ich mich, nach einer weiteren gewonnenen Serpentine, keuchend in den Schatten - und finde, dass die Straßenplaner hier nicht mehr und nicht weniger als die schlimmste Straße der Welt gebaut haben - alles, nur nicht noch weiter hoch müssen! Alles, nur nicht noch mehr treten! Und noch nicht einmal die Hälfte geschafft! Marc ist auch nicht mehr zu sehen.
Ich bin allein und fahre mein Tempo. Wobei Tempo hier ganz sicher der falsche Begriff ist. Ich schleiche mich diese Straße hinauf. Die Steigungen werden immer fieser - bissige, garstige Rampen, kurz zwar, aber dafür steiler. So steil, dass ich hart an der Grenze zum Umfallen fahre. Dann versinke ich im eigenen Schweiß, der nirgendwo ablaufen kann, der durch keinen Windzug getrocknet wird. Dann steigt die Hitze wie aus einem geöffneten Pizzaofen von meiner glühenden Brust auf, brennt förmlich in meinen Augen, die ständig blinzeln müssen, um den Wasserschwall der Tropfen, die unter dem Helm nur so hervorquellen, loszuwerden.
Die Beine kurbeln wie automatisch - ich selbst stecke nicht mehr hinter ihren Bewegungen. Ich atme schwer und kurz. Es ist nicht so, dass ich nur außer Puste wäre. Ich kann einfach nicht mehr.
Gedanken kreisen durch meinen Kopf. Das ist heute unser zweiter Tag. Wie werde ich mich wohl am Ende dieser Woche fühlen? Nach all den Pässen, all den Kilometern, nach Myriaden von Höhenmetern? Immer mehr, immer höher, immer härter! Dieser Anstieg hier nimmt und nimmt kein Ende! Unendlich, die Quälerei - mal ehrlich Leute, 5,6,7 meinetwegen auch 9 oder 10 Prozent sind ja noch ganz spaßig - aber hier hat es 15 ... bitte ... das ist Quälerei! Da kommt die nächste Kurve, sie erscheint über mir, etwa 1.000 Meter entfernt. Langsam nur, in Zeitlupe, schneckenartig und wie Gummi gedehnt schiebe ich mich Zentimeter um Zentimeter dieser Kurve entgegen. Dann, Minuten vergehen, fühlen sich an, wie Stunden, dann endlich, fahre ich ein, in die Kurve. Erwarte das Abflachen der Steigung. Zum Glück wird es jetzt deutlich flacher – nur noch 8 Prozent Steigung. Fast muss ich mich bremsen und wundere mich ob des schnellen Aufstieges. Soll das jetzt schon alles gewesen sein? Ich kurbele wie ein Berserker, als ich die Wand erklimme, an deren Ende, weit, weit über mir, ein kleines schwarzes Schild prangt. Ich komme kaum in den zweistelligen Geschwindigkeitsbereich, schüttele den Kopf! Bin ich wirklich richtig fertig, aber beim letzten Mal kam mir der Anstieg viel länger vor.
Aber nun sehe ich vor mir die letzten Kehren. Es ist ein tolles Gefühl. Erhebend - keine Frage. Matt und abgekämpft kurbele ich die letzten Meter. Freudig, fast besoffen von Endorphin und Adrenalin ignoriere ich das Stechen in meinen Lungen. ich freue mich wie ein kleines Kind!
Wie, als fahre ich in den Himmel, biegt die Straße noch einmal nach links ab.
Dann wird’s flach.
Ich habe es geschafft. Ich bin oben.
Tief atmend stehe ich dann vor unendlicher Weite und spüre das pure Glück. Ich spüre meinen Körper, ich spüre meine Freiheit, stehe am Passschild und warte auf Marc. Ich will meine Freude mit ihm teilen. Breit grinsend kommt er oben an. Wie geil ist das denn bitte! Wir klatschen uns ab und sind begeistert. Von hier oben ist die Aussicht einfach phänomenal. Ein Panorama wie gemalt. Überwältigend. Worte können es kaum beschreiben, denn Momente wie dieser lassen all die Anstrengung, all den Schweiß, all die Mühen vergessen. Vorgestern noch den ganzen Tag im Auto gesessen und jetzt und hier stehen und diesen Anblick genießen können. Unbezahlbar. Anlehnen. Füße ausstrecken. Und genießend in sich ruhen. Der Moment könnte schöner nicht sein.
Wir gönnen uns einen leckeren Kaffee und eine eiskalte Orangina, sinken in die bereit stehenden Liegestühle und lassen uns von der Sonne verwöhnen. Hach!, atme ich lange ein und aus - ich kann mich hieran gar nicht satt sehen! Ich blicke in die Ferne, während mein Puls sich wieder beruhigt. Mein Blick wandert von Gipfel zu Gipfel, ich verliere den Fokus, ich träume mit offenen Augen.
Was für ein bombastisches Panorama, was für ein spektakulärer Ausblick. Welch Atemberaubende Schönheit diese schroffen Gipfel erzeugen. Ganz klein, wie Ameisen, die Menschen. Ehrfurcht angesichts dieser scheinbar Millionen Jahre überdauernden Steinmassive, die uns so unbedeutend erscheinen lassen.
Nach etwa 30 Minuten machen wir uns zum Abflug bereit. Ein kurzer Blick hinunter ins westliche Tal: Da ist die Abfahrt, da geht es gleich runter! Wow, was für ein Anblick! Wir freuen uns auf die Abfahrt. Dieser unbarmherzig steile Berg ist geschafft. Abfahrt nach Briançon bei über 35 Grad. Und wenn schon, denke ich mir. Auf geht’s.
Ab in den Unterlenker und Vollgas. Der Fahrtwind brüllt mir entgegen und kalte Tränen laufen die Wangen herab. Und dann, dann stehen auf einmal Schilder da. Warnen vor 10 Prozent Gefälle. Gefälle? Gefällt mir! Ab geht es. Ich lasse rollen. Okay, hochschalten, beschleunigen - wenn schon, dann will ich hier auch richtig Wind um die Ohren haben. Mit 40, 50, 60 km/h geht es bergab. Hoch über uns die mächtigen Spitzen der umliegenden Berge. Unten, durch Geröllwüsten und karge Wiesen, schlängelt sich eine bisweilen gefährlich mit Rollsplitt geflickte Straße. Ein Grund mehr, es in dieser Abfahrt nicht komplett krachen zu lassen. Wahnsinn, wie lange es dauert, bis wir wieder die Baumgrenze erreichen. Schon unzählige Serpentinen, scheint es, haben wir geritten - und noch immer kein Ende in Sicht. Im Rausch der schiefen Ebene schießt die Geschwindigkeit auf dem Garmin sofort nach oben, wenn wir die Bremsen los- und das Rad rollen lassen.
Ich könnte das stundenlang machen. Mache ich ja auch gerade. Ab und zu halte ich an und fotografiere Marc beim Durchfahren der engen Kurven, dann steige ich wieder auf mein Rad und starte die Aufholjagd. Viel schneller, als gedacht, kommen wir wieder unten an. Vom Bremsen schmerzen die Hände, aber wir grinsen breit in die Glutofenhitze. Geil war es!
Wir reiten in Briançon ein. Die Stadt glüht, mein Kopf auch. Aber hey, wir haben den Granon im Sack. Ich stelle mein Rad ab und pausiere erst einmal für einige Minuten. Das war eine herrliche Etappe heute. Einmal bergauf, einmal bergab. Das war´s. Vielleicht ist es der seichte Wind, der durch die Vorhänge meines Zimmers zieht, vielleicht ist es das Erlebnis dieses Tages - jedenfalls schlafe ich wie ein Gott. Perfekt - entspannt, erholsam. Keine Abstriche, kein Minus, es ist, als bin ich im Himmel.
Lacets de Montvernier und Col du Chaussy
Der gestrige Tag war gigantisch, aber was heute auf dem Plan stand, würde es noch toppen. Ein wunderbarer Serpentinen-Spaß, den jeder einmal mit dem Rennrad gefahren sein sollte. Deshalb machten wir uns ganz früh mit dem Auto auf den Weg nach Saint-Jean-de-Maurienne. Das kleine Örtchen ist weltberühmt für die in Pontamafrey startende Montvernier-Serpentinenstraße, die auf wenigen Kilometern mit 18 engen Kehren fast 300 Höhenmeter erklimmt, bevor Montvernier erreicht ist.
Bei der Tour de France 2015 versetzte der majestätische Anblick dieses Serpentinen-Anstiegs unzählige Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt in Staunen. Die Kurvenstraße von Montvernier ist weder besonders steil, noch ist dieser erste Abschnitt hin zum Col du Chaussy besonders lang.
Trotzdem gehören die Lacets de Montvernier zu einem der beeindruckendsten Kunstwerke des Straßenbaus in den französischen Alpen.
Ihre Schönheit wird einem wohl erst beim Betrachten der zahlreichen Luftaufnahmen deutlich, die online zu finden sind. Schwungvoll schlingen sich die Serpentinen an einem steilen Hang den Berg hinauf. Da kommt fast Achterbahn-Feeling auf. Die Lacets sind für mich eines der Highlights mit dem Rad überhaupt.
Seit ich sie gesehen hatte, wollte ich hierher. Wenn man sie fährt ist es echt schwer, sie in einem Foto einzufangen.
Es sind die ersten vier Kilometer der Süd-Rampe zum Col du Chaussy (1.532 m), unweit des Tour-Dauergastes Col de la Madeleine. Bis zur Tour de France 2015 lag dieses Schmuckstück, zumindest was den Radsport betrifft, im Dornröschenschlaf neben der Autobahn A43. Dann aber standen sie schlagartig im Rampenlicht – der Berg, über den am meisten gesprochen wurde, und das bei nur 2,5 km Länge und 8% mittlerer Steigung.
Wenn man auf der Autobahn durchs Tal fährt, kann man diesen Anstieg leicht übersehen. Versteckt im Fels, ohne Hinweisschilder und jegliches Tamtam ist er ein Geheimtipp für Eingeweihte und unbedingt eine Tour wert, wenn man sich in der Region befindet. Er beginnt in einem kleinen Ort namens La Tour-en-Maurienne, wo man an einem Fahrrad in den Farben des Gelben Trikots der Tour de France und einem Hinweis zum „Col du Chaussy par Les Lacets“ vorbeifährt.
Kein weiterer Hinweis, der auf eine ganz besondere Strecke hindeuten könnte. Im Ort muss man auf den aufragenden Berg schauen, um den Anstieg zu sehen, und einige hundert Meter nach dem Ortsausgang beginnen sie.
Die spektakulärsten Serpentinen der Welt.
Auf jeden Fall ein absolutes Muss für jeden Liebhaber kurvenreicher, langsamer und aussichtsreicher Fahrerei. Man hat sofort nach dem Start eine fantastische Aussicht auf das Tal. Der Traum bergauf, da Du in jeder Kurve die Aussicht genießen kannst. Ich fahre sofort auf dem kleinen Blatt, ab und zu muss ich schlucken - Druck auf den Ohren, Laktat in den Beinen, während ich hier die Steigung hinauf krieche. Achtzehn übereinander gestapelte Haarnadelkurven führen vom Tal kunstvoll nach oben.
Siebzehn dieser Kurven winden sich innerhalb einer Distanz von nur zwei Kilometern, was bedeutet, dass etwa alle 120 Meter ein Richtungswechsel von knapp 180° ansteht. Dieses umwerfende Stück ruhige und schmale Straße scheint wie für’s Radfahren gemacht zu sein.
Nur ein wackeliges Geländer schützt - optisch - vor dem Abgrund. Das Wort „Fahrbahnbreite“ kann man hier getrost vergessen. Wenn hier drei Leute nebeneinander fahren, hat der Vierte schon ein Problem. Irgendwann steht mein Mund nur noch offen. Hier geht kein Lüftchen. Vielmehr steht die Hitze hier, befeuert von einer unerbittlich knallenden Sonne. Ich schalte einige Gänge nach unten und beginne, langsam zu kurbeln. Wir haben zwei, drei Serpentinen hinter uns und die Straße legt sich an den Fels. Es schlängelt sich sanft bergan, keine 7% mag es hier haben, aber wenn ich nach unten, neben mich blicke, geht es fast senkrecht hinab. Marc ist nur eine Serpentine unter mir, gefühlt schaue ich aber 50 Meter hinab.
"Wow, wir geil ist das denn hier!?", rufe ich ihm begeistert zu. Er schaut mich nur kurz kopfschüttelnd an. Ich kurbele mich im kleinsten Gang die Wand empor. Über mir haben sie die Straße regelrecht in den Fels gefräst - ich freue mich darauf, wenn ich gleich dort oben bin. Die Straße schickt sich an, zur senkrechten Mauer zu werden. Ich kämpfe mich eine immer absurder ansteigende, immer enger werdende, kleine Landstraße hinauf. Schaue ich nach oben, sehe ich immer mehr Serpentinen, ein wahres Paradies für Kurvenfetischisten. Kurve um Kurve geht es aufwärts.
Ich staune immer wieder, wie Menschen eigentlich dazu kommen, so eine wahnsinnige Straßen in diese unwirklichen Gegenden zu bauen? Links, rechts, links, rechts, bei dieser Intensität fällt es schwer, nicht mit voller Energie zu fahren, hinter jeder Kurve wartet eine neue Aussicht, du willst wissen, was hinter der nächsten Kurve wartet, aber leider ist das Spektakel irgendwann zu Ende (anders als bei vielen anderen Anstiegen gibt es hier keine Hinweisschilder mit nummerierten Kurven) und geht in einen geraden Abschnitt bis zum Gipfel über, wo am Straßenrand ein unscheinbares Schild wartet.
Das war ein herrlicher Aufgalopp, ein traumhafter Beginn für etwas, was mir die Sprache verschlagen wird. Es geht weiter zum Col du Chaussy. Da keine größeren Ortschaften an der Straße liegen, ist diese sehr wenig befahren. Auf der Südseite wurde die Trasse herrlich an den Hang gebaut. Anhand der vielen Hinweisschilder scheinen Steinschläge ein größeres Problem zu sein. Trotzdem ist es ein Genuss, an der Bergflanke nach oben zu klettern, auch wenn ab und zu ein scheuer Blick der Felswand entlang nach oben wandert. Die Straße hat einige Abnutzungserscheinungen. Ansonsten ist sie in einem guten Zustand.
Und so lullt uns der Anstieg ein.
Seicht geht es links und rechts und wieder links und wieder rechts. Fantastische Aussichten wechseln sich mit dunklen Waldpassagen ab. Die Gedanken sind längst wieder auf Reisen gegangen und ich träume mich wie im Trance die Steigung hinauf.
Es wird steiler. Die Hänge, an denen ich fahre, fallen fieser ab. Die Steigungen selbst werden länger und länger und die Ausblicke, die ich nun genießen kann, umso spektakulärer. Was es aber nicht wird, ist kühler. Normalerweise sinkt die Temperatur, je höher wir kommen. Hier nicht. Die Sonne brutzelt unerbittlich auf uns nieder. Trotz der vielen Sonnencreme verfärben sich meine Arme langsam rot. Ich weiß nicht, wie lange ich mich den Berg hinauf kämpfe. Es geht in lang gezogenen Kurven am Abhang entlang. Mal ist der Berg rechts, mal links. Mal kann ich fast senkrecht nach unten Blicken, wenn ich meinen Kopf drehe, mal warnen mich Schilder vor Steinschlag von oben.
Mit jeder Kehre eröffnen sich neue Tiefblicke ins Arc-Tal. Diese Kletterei an der Felswand entlang ist wirklich kurzweilig. Immer wieder muss ich anhalten und Fotos machen. Zu schön, zu überwältigend sind die Ausblicke. Bei aller Anstrengung, bei aller Plackerei, bei aller Hitze, dieser Berg ist einfach ein Traum. Ab und zu schalte ich einen Gang hoch, gehe in den Wiegetritt und drücke kraftvoll einige Dutzend Meter mit 15 km/h nach oben. Dann setze ich mich hin, atme durch, schalte herunter und bin wieder bei 10 km/h. So geht das Meter um Meter. Ich schwitze im gleißenden Sonnenlicht und stelle entsetzt fest, dass meine beiden Trinkflaschen nahezu leer sind.
Idiot, denke ich! Ich hoffe auf eine Quelle, eine kleine Tankstelle, ein Café – irgendwas. Aber es kommt nichts. Stattdessen kommen 10% Steigung - harte, giftige Rampen. Stattdessen brennt die Sonne - und kaum Schatten. Stattdessen fahre ich nah am Abgrund auf einer spektakulären Straße entlang. Neben mir eine Aussicht, dass es einem den Atem raubt. Aber was nützt mir der grandiose Ausblick, wenn ich hier auf Reserve fahre?
Oh man, fluche ich in mich hinein, wie kann man nur so doof sein?
Trikot und Handschuhe sind vom Schweiß völlig durchnässt. Ich röchle, finde kaum Spucke, um meinen Mund feucht zu halten und auch das Magenknurren wird langsam schmerzhaft. Und dann, unverhofft, aus dem Nichts, wie von Geisterhand, kommt meine Rettung. Nach fast 17 Kilometern öffnet sich die enge Felslandschaft, als ziehe jemand einen Vorhang beiseite und auf einem kleinen Plateau ist das Ziel. Viel schneller als gedacht bin ich oben am Gipfelschild. 1.532 Meter hoch und gefühlt 40° Hitze. Dort steht ein Brunnen mit glasklarem, eiskalten Wasser. Dankeschön lieber Gott, meine Gebete wurden erhört.
Danke, Danke, Danke!
Ich nehme meinen Helm ab und tauche meinen Kopf ins Wasser. Ich kann es förmlich zischen hören. Was für ein herrliches Gefühl. Am liebsten würde ich mich ganz in das Wasser legen. Wieder und wieder tauche ich mit dem Kopf ins Wasser. Dann fülle ich meine leeren Trinkflaschen und lassen das kühle Nass durch meine trockene Kehle laufen. Gierig schütte ich Liter für Liter in meinen ausgedörrten Körper. Herrlich…
Ich bin mal gespannt, wann und wie Marc hier ankommt. Ich lasse mich ins Gras plumpsen und warte. Und nun? Nun hocke ich hier, futtere einen Riegel und genieße meinen kleinen Triumph. Die Beine brennen, aber ich freue mich so, auch diesen Anstieg gemeistert zu haben. Das Adrenalin tropft mir zu den Ohren hinaus. Es sind diese Momente, die die Qual einer Steigung vergessen machen!
Trotz der Abkühlung tropft mir schon wieder der Schweiß von der Nase. Mein Gesicht ist verschmiert vom Schmutz der Straße. Mein Stolz ist grenzenlos. Und doch: Keine Zeitlupe. Kein Pathos. Kein Beifall. Nur ich und die Straße. Und dieses erhabene Gefühl des Triumphes. Ich esse einen zweiten Riegel.
Dann kommt Marc. Völlig ausgepumpt, atemlos, am Ende seiner Kräfte, fertig. Er ist richtig weich gekocht und trinkt fast den Brunnen leer. Diese Steigungen bei dieser Hitze zeigen einem doch ziemlich schnell die Grenzen auf. Es ist jetzt 12:00 Uhr, die Sonne steht direkt über uns, der Asphalt kocht und heiße Luft flimmert über der Straße. Alle – außer uns – haben sich längst ein schattiges Plätzchen gesucht. Ich versuche ihn aufzumuntern, denn ich weiß, jetzt kommt eine der schönsten Abfahrten, die ich kenne. Also los Großer, komm mit, jetzt lassen wir es krachen! Sieht wieder mal harmlos aus - aber hier geht die Luzie so richtig ab! Vor mir ringelt sich die Straße stark abwärts fallend in eine lange Linkskurve. Ich schalte hoch, beschleunige so gut ich kann, erreiche die maximale Drehzahl meiner Kassette und gehe in Unterlenkerhaltung. Dann konzentriere ich mich darauf, die optimale Linie zu finden, koordiniere den Wechsel zwischen Links- und Rechtskurve, versuche so wenig wie nötig zu bremsen und jauchze kurz auf, lasse nur einen Moment meine Konzentration locker, um diese Abfahrt zu genießen - Wow, was für ein Gefühl!
Mein Herz pocht, meine Räder fauchen nur so durch den Wind, nur der Freilauf rasselt surrend unter mir, sonst Stille, ich kann sogar Vögel zwitschern hören, als ich ins Tal zwischen den Bergen hinabsause, mir der Fahrtwind die heiß gelaufenen Knie kühlt und den Schweiß auf der nackten Brust trocknet. "Irgendwann muss diese Abfahrt doch einmal enden?", denke ich mir, tauche in die nächste Kurve und blicke in ein weites Tal, das da unter mir liegt. Das Rad senkt wieder die Nase, zeigt nach unten und wieder zieht mich die Erdanziehung automatisch nach bergab, beschleunigt mich. Zurück in Saint-Jean-de-Maurienne steige ich mit einem breiten Grinsen, glücklich und zufrieden von meinem Rennrad. Tage wie dieser sind unbezahlbar und die kann Dir keiner mehr nehmen. Ich schaue zurück auf die Lacets und bin einfach nur happy.
Jetzt habe ich Hunger. Also futtern wir uns die Bäuche voll und machen uns dann ganz entspannt auf den Rückweg nach Briançon. In unserem Appartement lege ich die Beine hoch. Geschafft für heute, beglückwünsche ich mich, proste meinem Bike zu und schaue auf die morgige Tour. Es erwartet uns eine weitere Legende. Morgen kommt Alpe d´Huez. Morgen kommt die Bühne der Helden. Die 21 Kurven.
DIE EINUNDZWANZIG KURVEN.
Alpe d´Huez und Col de Sarenne
Es gibt viele berühmte Berge in Frankreich. Berge, deren Namen in den Ohren von Radsportfans wie Musik klingen. Es sind die epischen Anstiege der Tour de France, es sind die richtig dicken Dinger. Col du Galibier. Mont Ventoux. Col du Tourmalet. Wer alljährlich die Tour de France vor dem Fernseher verfolgt, dem sind diese Namen vertraut. Aber keiner, wirklich keiner, ruft so viele Emotionen hervor wie dieser Ort:
Alpe d’Huez.
Dabei ist dieser Anstieg weder der längste, noch ist er der höchste und auch nicht der steilste Anstieg in den französischen Alpen. Auch wenn Alpe d’Huez in erster Linie ein Wintersportort ist, verdankt er seinen hohen Bekanntheitsgrad vor allem der Tour de France, denn dank ihr ist er sicherlich der bekannteste Anstieg. Wer an die Tour denkt, hat die Alpe vor Augen. Pantani, Ullrich, Armstrong. Massen von frenetischen Fans bilden ein Spalier und brüllen ihre Helden den Hang hinauf. Unglaublicher Lärm, Rauch von hunderten Bengalos, Stimmung auf dem Siedepunkt. Das ist Gänsehautfeeling pur. Und deshalb gilt: Jeder Rennradfahrer MUSS die Auffahrt nach Alpe d’Huez einmal im Leben gefahren sein. Es zieht Freizeitsportler aus aller Welt dorthin. Sie wollen spüren wie es sich anfühlt an seine körperlichen Grenzen zu stoßen und das herrliche Gefühl erleben, dieses Biest bezwungen zu haben. Millionen Radfahrer sind diesen Anstieg gefahren, unzählige Male wurde er gezeigt.
Alpe d’Huez ist tatsächlich der erste bedeutende Anstieg des Radsports, den ich als Radsportfan bewusst wahrgenommen habe und der mich sofort fasziniert hat. Welche Leiden mussten an den Hängen schon ertragen werden, ob von den Profis oder von denen, die einfach nur gerne Rennrad fahren und auch einmal in ihrem Leben diesen Berg bezwingen wollten. Selbst schuld, man muss das ja nicht tun. Man sucht sich das ja selber aus. Die Straße dorthin ist ein aus 21 Serpentinen bestehendes Versprechen auf Spektakel, ein 13,8 Kilometer langer Kampf von Le Bourg d’Oisans hinauf auf 1.850 Meter über dem Meeresspiegel, dem die Jahrzehnte nichts von seiner Außergewöhnlichkeit genommen haben. Alpe d’Huez ist ein Mythos. 21 Kehren, in denen sich schon zahllose Tour de France-Dramen abgespielt haben. In diese Geschichte werden wir heute eintauchen. Diesen Mythos erfahren und uns anstecken lassen. Wir werden die Alpe platt bügeln. Aber heute stehen keine Menschenmassen Spalier, heute gibt es keine Bengalos, heute rennen keine irren Fans hinter uns her.
Die italienische Legende Marco Pantani hält den offiziellen Rekord. Er startete in Bourg d’Oisans und legte die Strecke in 37 Minuten und 35 Sekunden zurück. Vollgepumpt mit Epo, Wachstumshormonen und was weiß ich noch für einem Zeug. Mein persönlicher Erfolg stellt sich mit der Egalisierung dieses Streckenrekords mit 37 Minuten ein. Einziger Unterschied: bei mir steht vorne noch eine 1 davor, konkret 1 Stunde und 37min 😊. Nein, im Ernst: Wir wollen hier keine Bestzeit erzielen. Das ist nicht unser Anspruch. Für uns geht es um das Erlebnis Alpe d´Huez an sich. Um das Gefühl, diese legende zu erfahren, zu genießen und aufzusaugen. Die nackten Zahlen: Durchschnittliche Steigung: 8,1%, 1.071 Höhenmeter. Das Ganze verpackt in eine recht gleichmäßige Steigung.
Wir gehen es an. Auf geht’s nach oben. Es ist ruhig, als wir losrollen. Alles wirkt vertraut und doch so ganz anders, als im Fernsehen. Dieser Anstieg knallt mir gleich zu Beginn einen ordentlichen Hieb in den Bauch. Es wirkt fast, als würde der Pass mir noch einmal zurufen: "Willst du dir das wirklich antun?" Ja, nicke ich, ich will! Jetzt noch links um die Kurve, dann kann ich sie sehen, die erste Rampe, kann erkennen, wie steil sie ist. Kaum biege ich um die Ecke, sehe ich eine kerzengerade Strecke, die mich nicht an eine Straße sondern an eine Skisprung-Schanze erinnert. Als graues Band verengt sich die Straße dort oben, dort hinten im Irgendwo. Rechts eine Sandsteinmauer, links hohe Bäume am Abhang. Alles liegt im Schatten. Diffuses Licht. Mir ist ein bisschen mulmig zumute. Wie wird es sich anfühlen? Wie lange wird es dauern? Ich habe Respekt vor diesem Berg. Das Thermometer zeigt 26 Grad an. Wie sollen wir den Anstieg nach Alpe d’Huez hochkurbeln, von dem der Schriftseller Garvia meinte, dass er einen in „Stücke reißt”? Ganz langsam? Mit genügend Reserven? Wo waren jetzt nochmal die fiesesten Steigungsprozente? Gibt es zwischendurch eine Möglichkeit, unsere Flaschen aufzufüllen?
Fragen über Fragen…Wann werden wir oben ankommen? Sicherlich wieder um die Mittagszeit. Wieder in der größten Hitze des Tages. Naja, so schlimm wird es schon nicht werden.
Alpe d´Huez ist eine Zumutung. Alpe d´Huez ist ein Traum. Wer eine Leidensprozession von Menschen in bunter Radwäsche erleben möchte, sieht eine lange Kolonne verzweifelter Zombies, die mit letzter Kraft eine der legendärsten Strecken der Tour de France versuchen zu bezwingen. Und man sieht wirklich alles. Ausgezehrte 45 Kg-Männchen, die mit sündhaft teurem Material schwarze Streifen in den Asphalt brennen. Ältere Herren mit sonnengegerbter Haut, die mit Heldenübersetzungen und unfassbar niedriger Trittfrequenz unterwegs sind und von uns überholt werden. Männlein, Weiblein, Jung und Alt, alles quält sich hier hinauf.
Die Steigung beginnt brutal. Vor mir ragt der Asphalt der ersten Geraden auf, das heißt für mich 34-30, mein kleinster Gang. Auch nach der ersten Kehre bleibt es steil. Die Steigung auf den ersten beiden Kilometern liegt im zweistelligen Bereich. Ich trete. Ich trete auf der Rampe. Mal sitzend, mal stehend. Ich schleiche, so kommt es mir vor. Der Mund steht mir weit offen, mein Trikot auch. In meiner Brust hämmert mein Herz. Die Augen kneife ich zu schmalen Schlitzen zusammen. Ich bin frohen Mutes, auch wenn ich langsam bin. Kopf nach unten, treten. Mein Blick geht auf meinen Computer am Vorbau. 160, die Herzfrequenz passt. Noch. So finde ich schnell in einen runden Tritt. Und trete mich durch die Natur. Die Sonne brennt, kann mich aber nicht abschrecken. Nichts hält mich auf. Nicht hier. Nicht jetzt. Nicht heute. Heute erobere ich mir diese Legende!
Nur nicht überziehen. So früh schon so steil? Das Treten wird zum Stampfen. Ein Stampfen im Kampf gegen die Legende. Eine Legende wegen der großen Namen. In jeder Kurve lese ich einen: Coppi, Hinault, Pantani. Wer hier eine Tour-de-France-Etappe gewinnt, bekommt sein Schild in einer Kehre. Für mich ist es Motivation: Keinen Anstieg wollte ich je so sehr bezwingen. Ein Berg wie ein Altar. Ich habe schon 2,5 Kilometer geschafft und passiere ein Schild, auf das jemand einen Aufkleber mit einer kleinen Schnecke geklebt hat. Witzbold. Kurze Zeit später ist Grillenzirpen zu hören. Links kommt eine hübsche Blumenwiese in Sicht. Idyllisch. Ab dem kleinen Örtchen La Garde (Kurve 6) geht die Straße in ein längeres, recht steiles Geradeausstück über. In sengender Sonne breitet sich rechts neben und unter mir tief geschnitten eine Schlucht aus, weiter hinten kann ich Bourg d´Oisans erkennen, ein grandioser Ausblick.
Marc ist weitab hinter mir. Ab und zu kann ich ihn in den Kurven unter mir sehen. Nach wenigen Kurven bin ich in unerwarteter Höhe: Bourg d’Oisans liegt tief unter mir. Ich blicke über das Tal hinab und auf die Berge ringsum, die nun bereits viel weniger hoch erscheinen. Ich kämpfe. Kämpfe wirklich. Schweiß beginnt in Strömen zu laufen und meine Trinkflasche - scheiß auf die warme Brühe! - leert sich beängstigend schnell. Ich trete, trete mich in Trance, versuche es zumindest, denn die Trance macht, dass der Wadenschmerz weg geht. Versuche, mich im Lichtspiel, das die Sonne auf dem beständigen Auf und Ab meiner nassen Oberschenkel veranstaltet, zu verlieren. Und puste. Und atme. Und trete. Und stöhne. Und reiße mich am Riemen. Und leide.
Obwohl ich nicht sehr schnell unterwegs bin, rolle ich stetig an anderen Radfahrern mit sündhaft teurem Material vorbei. Kehre 8 auf 1.345 Metern. Mehr als 600 Höhenmeter sind schon geschafft. Kommen nur noch… ach, lassen wir das. Jetzt habe ich einen Rhythmus gefunden. Meinen Rhythmus. Es ist, als ob die gestrichelte Linie auf dem Asphalt am rechten Rand der Straße an mir vorbeikriecht und nicht ich an ihr. Zweifel wechselt sich ab mit Euphorie. Ich werde es schaffen! Bald werde ich am Gipfel belohnt.
Ich bin wieder allein am Berg. Mit mir, mit dem Wind, dem Rauschen in den Baumwipfeln, fernen Geräuschen, stillen Kondensstreifen, die sich wie Lindwürmer durch den blauen Himmel winden und allein mit dem Surren meiner Kette unter mir, dem stoßweisen Atmen, meinen verkrampften Fingern am Lenker, dem Schweiß auf meinen Waden - allein. Ich schaue an mir herab, atme auf meine Brust und spüre meinen heißen Atem. Dann wird mir erst richtig bewusst, auf einmal, wie schwer diese Etappe doch ist. Wie hart dieser Anstieg, den ich mir schön gekurbelt habe, dessen Schmerz die Trance des Fahrens abklingen ließ, der aber immer mal wieder durch kommt. Und plötzlich fühle ich, wie sehr meine Waden schmerzen und realisiere, dass sie schon seit Kilometern weh tun. Müde Beine, denke ich, ich armen Dinger - und das hier ist erst der erste Anstieg. Der Kleinere. Es folgt ja noch der Col de Sarenne…
Dann aber holt mich wieder die Realität des Berges ein. Die brutale Steigung verlangt meine Aufmerksamkeit. Der kochende Asphalt fordert seinen Tribut - was denkst du an einen fernen Pass, wo du noch nicht einmal diesen hier gemeistert hast? Dann richte ich mich auf, entspanne meine Rückenmuskulatur, verlangsame bewusst das Tempo und schaue weg, weg von der Straße, weg vom Asphalt, weg von 8 Prozent Steigung. Und blicke hinüber zu den Bergen, wie sie majestätisch dastehen. Blicke hinab in die bewaldeten Täler, Blicke auf das vorhin…
Ich halte kurz an und staune mit großen Augen. Steige ab, stelle mein Rad an einen der Steine und muss ein Foto vor der Leere machen, um für einen Moment inne zu halten. Angehoben auf eine andere Ebene. Unter mir nichts als Natur. Kein Mensch zu sehen. Kein Haus. Kein nichts. Nur die schmale Straße, die sich hier, die letzten Kilometer so atemberaubend am steilen Abhang entlang schlängelt. Wo ich auch hinsehe, es sind Bilder der Superlative - da unten, da war ich eben noch! Faszinierend, wie viel Höhenmeter man mit nur einer Serpentine macht! Und ebenso faszinierend, wie leicht und schnell es dann doch geht. Ich berausche mich an diesem Anblick, fummele einen Riegel aus der Trikottasche, reiße ich die Verpackung mit den Zähnen auf und beiße ab, kaue, atme, kaue, atme. Die braune Masse wird zu einem zähen Brei, einer nach Mango schmeckenden Pampe. Sie herunterzuwürgen macht echt große Probleme. Noch 4,5 Kilometer bis zum Ziel. Ich spüle mit warmem Wasser aus meiner Trinkflasche hinterher. Dann schnappe ich mir mein Rad und weiter geht’s.
In Kehre 5 auf 1.512 Metern gehe ich aus dem Sattel, um mein Fahrrad und mich die nächste Rampe hinauf zu wuchten. Irre, wie steil die Kurven sind. Die Geraden dazwischen rollt es richtig gut, aber diese Kurven sind krass. Jetzt ist es ein Kampf. Ein epischer Kampf. Nicht nur gegen die Steigung, sondern auch gegen meinen inneren Schweinehund.
Brütende Mittagshitze, kaum noch schattige Passagen, dazu die Pässe der letzten Tage in den Beinen. Die Reifen scheinen am heißen Asphalt kleben zu bleiben. Alles brennt, die Beine, der Hintern und auch die Augen, in die der Schweiß von der Stirn stetig rinnt. Ich bin schon über eine Stunde unterwegs. Eine Stunde konstant bergan. Eine Stunde Kurbeln in der Vertikalen. Und das bei einem Schnitt von „nur“ 8,4% Steigung. Zahlen, nichts als Zahlen, die denen, die das hier noch nie gemacht haben, nichts sagen können. Die nichts aussagen über die Härte des Asphalts, die unzähligen, kleinen Rampen, die dieser Berg parat hat für den der es wagt, ihn entweihen zu wollen. Zahlen, die keine Auskunft darüber geben, wie schwer Beine sich anfühlen können, wie viele Liter Schweiß auf den Asphalt tropfen, wie elend lang sich 14 Kilometer Anstieg anfühlen können. So würde sich eine Zahnpastatube fühlen, wäre sie lebendig: Man quetscht sie und drückt und denkt, es kommt nichts mehr – und dann kommt doch noch etwas aus einem heraus, gerade noch genügend.
Mein Tritt in die Pedale ist schwerfällig, die Straße ist hier 9,5 Prozent steil. Auch das Weltklasse-Panorama hilft jetzt wenig, weil meine Beine langsam nicht mehr wollen. Der Berg nimmt mir alles. Saugt es raus aus mir, es verschwindet im Nirgendwo. Verschwindet in jedem Meter Steigung, sickert ein im heißen Bitumen wie Wasser in der Wüste. Mein kostbares Salz, meine Energie, meine Kraft. Nicht schleichend, wie sonst. Nicht langsam, nicht hinterrücks. Nein, dies ist keine dieser elend langen Etappen, bei denen man erst nach und nach bemerkt, wie einem die Kräfte entzogen werden. Dies hier ist live. Hier geht es direkt, ohne Umwege: Steigung, Kraft und Verschleiß. Die Gleichung, der ich mich zu beugen habe. So kämpfe ich mich hoch, von Kurve zu Kurve. Schwer geht es - aber, und das ist gottseidank immer der nächste Gedanke - es ist so wunderschön hier, so belebend, so überwältigend, dass es sich schon tausendfach gelohnt hat, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Der Blick auf die Berghänge, diese Straße, jahrhundertealter Pass, lange, bevor der Mensch sich dieses Tal erschloss mit seinem Beton und Asphalt. Ich grinse in meinem Schmerz. Ich lache bei meinem Fluchen. Ich freue mich im Leid. Es ist großartig hier, denke ich, und kehre ins Hier und Jetzt zurück. In den Schmerz der Senkrechten. Wo Marc wohl gerade ist? So sehr ich mich auch anstrenge, so sehr ich den Kopf drehe, ich kann ihn nicht entdecken.
Meine rechte Wade krampft. Zum Glück ist es jetzt nicht mehr weit. Ich habe noch einen Kilometer bis zum Ziel, gehe wieder aus dem Sattel und hole alles aus meinem Körper heraus. Vor mir torkeln andere Radfahrer die Steigung hinauf. Die sehen deutlich fertiger aus, als ich. Ich ziehe an ihnen vorbei und grinse breit. Geht doch. Kaum ist ein anderer Fahrer vor mir, liegt die Lunte aus und ich muss vorbei. So hangele ich mich den letzten Kilometer Stück für Stück nach vorn. Kehre 1. Scharfe Rechtskurve. Von jetzt an fährt sich dieser Anstieg wie von selbst. Ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht. Der Schmerz rückt in den Hintergrund, die Vorfreude auf das Panorama, das mich gleich erwarten wird, steigt. Gerade fuhr ich noch Zick-Zack, um die Steigung etwas aus dem Berg zu nehmen und jetzt fliege ich nur noch so hoch – mit bestimmt sagenhaften 10 Km/h. Noch einmal kurz durchschnaufen und dann auf in den Endspurt. Noch 500 Meter.
Das Ende ist nah. Plötzlich lässt die Steigung nach, die Straße wird etwas flacher. Noch 200 Meter. Schmerz lass nach! Die Zielgerade von Alpe d’Huez liegt auf einer gut zehn Meter breiten, mies geteerten Straße mit vielen Löchern und Rissen. Schmuckloser geht es kaum. Ein letztes Mal gehe ich aus dem Sattel, kurbele im Wiegetritt die finalen Meter hoch.
Dann passiere ich das Arrivé-Schild. 1.860 Meter Passhöhe. 14 Kilometer Anstieg. 1.132 Höhenmeter gemacht. Eine Erfahrung fürs Leben. Und wieder dieses Gefühl, dass diese Tour etwas ganz Besonderes ist. Hier, genau an der Stelle, wo ich stehe, war das Peloton der Tour de France vorbeigerauscht. Bei der 100. Ausgabe der Tour mussten die Profis den Berg sogar gleich zweimal auf einer Etappe bezwingen! Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich schafften sie das in der gleichen Zeit wie ich für einmal hoch! Na und? Dafür haben sie auch deutlich weniger Fotos als ich gemacht 😊.
Und da stehe ich nun oben, atme durch und blicke auf die schneebedeckten Gipfel in der Ferne und bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin im Ziel, habe das Biest „Alpe d’Huez“ gemeistert. Ich fühle mich wie eine echte Legende. Zumindest wie eine kleine.
Alpe d`Huez - ich habe Dich im Sack!
Ich warte darauf, dass Marc bald um die Ecke geschnauft kommt, denn ich will meine Freude mit ihm teilen. Und Marc? Der ruft kurze Zeit später an und fragt, wo ich denn abgeblieben sei. Ich bin verwirrt. Er hat mich doch nicht überholt? Das hätte ich doch gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Des Rätsels Lösung? Er ist nach Kehre Nr. 2 einfach rechts abgebogen und auf einem „Schleichweg“ nach Alpe d`Huez gefahren und hat dabei gar nicht bemerkt, dass er nicht mehr auf der „richtigen“ Strecke ist. Wir lachen beide herzhaft und beschließen, die restliche Strecke lieber mal gemeinsam zu absolvieren 😊.
Wer nach Alpe d’Huez kommt, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, nicht den gleichen Weg bergab zu fahren, sondern den Abstecher zum Col de Sarenne zu machen, denn dieser Weg ist landschaftlich einfach grandios und entgegen einer weitverbreiteten Meinung keine Sackgasse.
Ein Pass, der sich versteckt, ist immer einen Abstecher wert.
Sobald man nach all dem Trubel in Alpe d´Huez den Flughafen passiert hat, befindet man sich in einer völlig anderen Welt. Die Szenerie ändert sich schlagartig. Eben noch hunderte andere Radfahrer und nun hier…nix. Kaum lassen wir den Ort hinter uns, sind wir allein. Wir entfliehen dem Trubel des Wintersportortes und genießen diese Stille und die Schönheit der Alpen. Absolute Stille. Man hat das Gefühl, vollkommen allein zu sein. Auf der nochmal knapp 8 Kilometer langen Straße hinauf zum Sarenne können wir ursprüngliche, pure Natur genießen - kaum eine Menschenseele verirrt sich hierher. Meine Beine sind heute richtig gut und es ist es ein Genuss, Kehre um Kehre nach oben zu fahren. Nicht brutal steil, aber brutal geil!
Allerdings ist der Asphalt unfassbar schlecht und die paar Höhenmeter kosten deshalb mehr Körner, als eigentlich notwendig wäre. Es ist jetzt natürlich Mittagszeit, brüllend heiß, nahezu windstill und es geht gleich wieder aufwärts. Steigung um die acht Prozent, keine Autos und auch keine Motorräder, die durchs Tal röhren – als wäre das Sträßchen für uns gesperrt. Nur das sanfte Surren der frisch geölten Fahrradkette und das friedliche Plätschern des Gebirgsbachs, in dessen glasklares Wasser man am liebsten hüpfen würde. Leck mich am Arsch ist das heiß! Meine Waden ersticken unter der Sonnencreme, eine dicke Schicht milchig-weißen Schweißes, immer wieder unterbrochen von feinen schwarzen Staubpartikeln von Straße und Auspuff. Herrlich. Die erste Trinkflasche ist auch schon wieder alle. Staubtrockene Luft, heißes Geflirre auf kochender Straße - dazu ab und zu ein Vogel. Sonst Stille, nichts als absolute Stille und dieses kontrastreiche Licht, das die Einsamkeit dieser überwältigenden Natur noch unwirklicher erscheinen lässt.
Ich halte an, lasse diesen Moment auf mich wirken. Kann jetzt schon sehen, wo ich in einer halben Stunde sein werde. Da hinten, da geht’s lang, da schlängelt sich der Weg am Hang hinauf.
Es ist fantastisch. Es ist unbeschreiblich.
Was für ein Kontrast. Da quält man sich auf der einen Seite des Berges gemeinsam mit hunderten anderen Rennradfahrern, Motorrädern und Autos die 21 Kehren von Alpe d´Huez hoch und hier, auf der anderen Seite, keine 10 Kilometer später, ist es absolut still, verlassen und wunderschön.
Irgendwie skurril.
Ich fliege hier fast die Straßen entlang und je höher ich steige, desto fantastischer, ja, desto atemberaubender werden die Aussichten, die ich genießen kann. Und dann. Dann senkt sich die Straße. Plötzlich. Ganz ohne Pauken oder Trompeten. Glanzlos. Bescheiden. Fast, als bedauere der Berg, dass er nun keine Prozente mehr für uns parat hat. Da steht ein Schild. Schmucklos. Nüchtern. Absolut unspektakulär. Kein Haus, kein Baum, kein Strauch…einfach ein Schild, ein Parkplatz mit 360° Bergpanorama pur und das war´s. Ich bin am Gipfel. Ganz oben angekommen. Pass Nr. 2 heute.
Das Panorama ist überwältigend. Ich sitze da, sprachlos und staune. Was für eine Aussicht. Was für ein unfassbar schönes Fleckchen Erde. Ich kann mich gar nicht satt sehen.
Und jetzt kommt die ultimative Zugabe. Von jetzt an nur noch runter, jubele ich. Hier ist der Berg erobert. Bezwungen. Abgehakt. Hier beginnt die von den Profis (im Rennen) zu Recht gefürchtete Strecke bergab über 27 Kehren zum Lac du Chambon.
Diese Abfahrt wird mir lange im Gedächtnis bleiben.
Die Straße knickt vor mir ab. Schlechter Asphalt, Unmengen an Split und teils tiefe Löcher lassen uns deutlich langsamer machen als sonst. Belohnt werden wir schließlich mit einem gigantischen Ritt auf der Rasierklinge, technisch sehr anspruchsvoll, aber mit Gänsehautfeeling und Dauergrinsen.
Direkt nach der ersten Kurve taucht die Straße unter mir ab und dann erfasst mich der Sog der schiefen Ebene. Er zieht mich mit, beschleunigt mich, macht, dass mir der Wind mit voller Wucht um die Ohren knallt, macht, dass der Freilauf ein Loblied auf die Abfahrt surrt. Ich ducke mich weg, mache mich ganz klein und werde schneller, schneller und immer schneller. Schieße von einer Kurve in die nächste, lenke, korrigiere, trete mal, wenn es kurz flacher wird, bremse hart, wenn die serpentinenartigen Kurven zu eng werden. Ich kann bis zum Horizont nur unbewohntes, bewaldetes Gebiet ausmachen. Da hinten schlängelt sich eine Straße dünn am mächtigen Berggipfel entlang. Sehr leer sieht es hier aus. Verlassen irgendwie, nicht erschlossen. Das Tal, in das wir fahren, ist nicht besiedelt, die Bergflanken voll bewaldet. Keine Skipiste trübt den Blick auf pure Natur, kein Skilift verschandelt den Abhang, wie eine hastig vernähte Narbe. Hoch oben schimmern die schneebedeckten Gipfel wie silberne Bänder. Es ist, als fahrenden wir durch eine Welt, die noch nicht von Menschen zersiedelt wurde. Plätscherndes Wasser, Felsen, Schafe und überwältigend schöne Aussichten. Ich liebe diese Streckenführung und kann mich gar nicht statt sehen. Immer wieder halte ich an und mache unzählige Fotos. Nach einer gefühlt ewigen Serpentinen-Abfahrt kommt man dann langsam wieder in der Zivilisation an. Ankommen. Absteigen. Hinsetzen. Der Ausblick auf den Chambon Stausee ist bei diesen Bedingungen schon fast kitschig.
Die Rückfahrt von dort zurück nach Le Bourg ist unspektakulär und mit gutem Wind unten in den Passagen der Schlucht ein flott-kribbeliges Erlebnis! Bei uns zeigt das Thermometer in der Sonne 40 Grad an. Bei diesen Temperaturen müssen wir nicht bolzen, geben uns Hitzefrei und rollen ganz gemütlich zurück nach Bourg d'Oisans. Zurück im Auto sind wir uns einig, dass es eine geniale Etappe war. Das Beste aus zwei völlig unterschiedlichen Welten. Hier der fast schon überfüllte, berühmte Anstieg nach Alpe d´Huez, dort der absolut menschenleere, stille und landschaftlich unbeschreibliche Anstieg zum Col de Sarenne und zum Schluss diese atemberaubende Abfahrt zum Stausee. Wir sind völlig geflasht.
Abends genehmige ich mir noch ein Siegerbier, ehe ich die Flügel meines Fensters weit öffne, den Vorhang vor den Mond ziehe und die heiße Nachtluft in mein Zimmer lasse. Morgen kann ich ausschlafen. Morgen ist unser Ruhetag. Morgen fahren wir mal nicht. Satt und glücklich sinke ich in die weiße Wäsche, dämmere weg und schlafe eine traumlose, aber vollkommen perfekte Nacht...
Ruhetag...😊
Heute ist also Ruhetag. Ein Tag, an dem wir mal nichts machen. Wirklich? Gar nichts? Naja, gar nichts geht ja irgendwie auch nicht…vielleicht gehen wir ein bisschen spazieren…
Zunächst einmal ist ausschlafen angesagt. Als ich wach werde, kitzelt die Sonne meine Nasenspitze und so krabbele ich aus dem Bett. Dann sitzen wir entspannt beim Frühstück, futtern Haferbrei und Pfannkuchen und überlegen, was wir an diesem Tag anstellen wollen.
Briançon ist spitze. Und das sogar wortwörtlich. Die Stadt thront malerisch auf 1.326 Metern Höhe. Keine Stadt liegt höher in Frankreich. Die etwa 12.000 Einwohner starke Gemeinde besteht aus zwei verschiedenen Stadtteilen. Der Unterstadt, in der unsere Ferienwohnung liegt und der befestigten Oberstadt. Hier findet sich die mittelalterliche Altstadt, um die Baumeister Vauban eine Befestigung baute. Die Festungsanlage ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und definitiv einen Besuch wert. Die Festungsanlagen von Briançon sind einzigartig in Europa. Innerhalb der Festungsanlage bezaubert Briançon mit einer außerordentlich gut erhaltenen Altstadt aus dem Mittelalter. Die wollen wir uns ansehen. Das ehemalige Militärlager Briançon wurde 1692 von Frankreichs berühmtestem Festungsbaumeister Vauban erbaut und gilt mit seinem meterdicken, doppelten Verteidigungsring, einer Zitadelle und mehreren kleinen Festungen heute als eine der sehenswertesten Städte der Alpen. Die Altstadt ist über die mächtige Stadttore zu erreichen. In den engen Gassen und kleinen Straßen erwarten Spaziergänger zahlreiche kleine Restaurants und Bars. Die Häuser sind aufgrund der geringen Grundfläche allesamt schmal und in die Höhe gebaut worden. An vielen Häuserfassaden sind Sonnenuhren angebracht, ein Hinweis auf das sehr sonnige Klima der Region. Authentische Zeugen des Mittelalters sind die nach oben geöffneten Wasserrinnen, die die Stadt von oben nach unten durchqueren. Man kann die Gässchen erkunden oder von den Festungswällen einen herrlichen Blick über die umliegenden Täler genießen. Was man allerdings nicht kann, ist einfach mal „normal“ spazieren gehen. Wie gehabt geht es entweder steil berghoch oder steil bergrunter. Gerade Wege scheint es hier nicht zu geben. So kraxeln wir also die „paar“ Höhenmeter von unserer Ferienwohnung hinauf zur Altstadt. Natürlich wieder mal bei blauem Himmel und einer unbarmherzig brennenden Sonne. Zum Glück liegen die engen Gassen der Altstadt im Schatten…
Wir genießen die herrlichen Ein- und Aussichten und unser Blick wandert immer wieder auf die gegenüber liegende Seite des Tals. Dort trohnt die mächtige Festung von Briançon, noch immer weit über uns. Und dann sehen wir diesen schmalen Weg, die auch aus dem Mittelalter stammende Brücke und die Ausschilderung. Hier also geht’s zur Festung.
Na los Marc, hin da!
Und so überqueren wir die mächtige Brücke, von der aus man einen fantastischen Blick auf Briançon hat, folgen dem geschotterten Weg und es geht – wie könnte es auch anders sein – in steilen Serpentinen stetig nach oben. Der Weg hinüber zum Fort entpuppt sich als ausgewachsene Wanderung, bei der wir – wieder mal – keine Ahnung hatten, was uns erwarten sollte.
Eigentlich wollten wir ja heute mal keine Höhenmeter machen, aber was soll´s. Wenn wir die Festung sehen wollen, müssen wir da jetzt hoch. Also biege ich links ab und denke mir, so schlimm wird´s schon nicht werden. Ein kurzes Stück berghoch, dann bin ich da. Und bleibe in einer Steigung stecken, die diese verrückten Franzosen hier in den Hang gezimmert haben - es geht mit mindestens 16, 17 % bergauf!
Ja neeee-is-klar! Äh, mache ich, und muss lachen. Das ist doch jetzt bitte nicht euer Ernst, oder? So stehe ich da und schaue fassungslos auf den vor uns liegenden Weg. Seid ihr bescheuert?, denke ich, wollt ihr mich verscheißern? Es sollte ein lockerer Spaziergang werden und jetzt stehe ich hier schon wieder atemlos im eigenen Saft und bei gefühlt 35° im Schatten läuft mir der Schweiß in Sturzbächen herunter.
Ruhetag – hatte er gesagt.
Spazieren gehen – hatte er gesagt.
Nix wildes, einfach ein bisschen die Beine bewegen – hatte er gesagt.
Ich schaue zu Marc, der einfach nur stumm den Kopf schüttelt. Wir stapfen auf dem alten Militärsträßchen, das uns durch eine steile Wald- und Felslandschaft hinaufführte. Richtig außer Atem – dieser Schotterweg ist wirklich scheiße steil!!! - sind wir echt froh, als wir die Festungsmauer sehen. Für den Aufstieg haben wir jetzt etwa 2 Stunden benötigt, runter geht´s deutlich schneller 😊. Keine technischen Schwierigkeiten - allerdings ging es kontinuierlich so knapp 400 Höhenmeter nach oben. Ein bisschen müssen wir noch kraxeln, dann erreichen wir die alten Burggräben. Auf schmalen Wegen geht es stetig weiter aufwärts. Das Fort ist leider geschlossen, schade. Der Wanderweg führt links im Bogen um die mächtigen Mauern herum. Ich probiere trotzdem jedes mögliche Tor und wir klettern in alle offenen Gänge, aber weit kommen wir nicht.
Zu unseren Fußen liegt Briançon, ein wahrlich erhabener Anblick.
Ringsherum diese riesigen Berge, der fast schon kitschig blaue Himmel, dem wir so nah sind und neben uns die Festung. So schauen wir uns alles ganz genau an, klettern über Mauern, krabbeln durchs Gestrüpp, schleichen durch einen kleinen Tunnel und fühlen uns ein wenig wie kleine Jungs auf einem Abenteuerspielplatz. Es ist fantastisch. Aber es ist auch unsäglich heiß, weshalb wir dann beschließen, wieder zurück nach Briançon zu gehen und uns in der kühlen Ferienwohnung auszuruhen.
Die Hitze hier lähmt uns.
Aber halt, da war ja noch etwas. Marc hatte bei unseren abendlichen Spaziergängen zum Essen eine Seilbahn entdeckt, die schnurstracks steil berghoch zum Mont Prorel führte. Dieser Berg ist 2.566 Meter hoch und in dieser Höhe sollte es doch deutlich kühler sein, als hier unten. Also ändern wir kurzer Hand unseren Plan und fahren mit der Seilbahn hinauf auf den Gipfel.
Also schnell die Fahrkarten gekauft und ab geht´s. Gemütlich schippert uns die Gondel nach oben. So kann man also auch mal ganz entspannt auf einen Berg kommen. Die Fahrt zum Gipfel bietet einen einzigartigen Einblick in die alpine Welt, wo die Luft dünn und die Aussicht unvergleichlich ist. Wir steigen aus der Bahn und schauen uns um. Ein Ort zum Atmen, Auftanken, um großes Glück und gleichzeitig Demut zu empfinden. Wir überschätzen uns oft selbst und geben uns im Weltgeschehen eine viel zu große Bedeutung. Wenn man die Größe dieser Berge hier sieht, merkt man erst, wie klein man ist.
Ein unvorstellbares 360° Panorama lässt uns sprachlos nebeneinander stehen. So kommt es, dass in kürzester Zeit alles, was eben noch wichtig und dringlich erschien, immer kleiner wird und, zumindest für den Moment, an Bedeutung verliert. Die gesamte schroffe Wildheit der französischen Alpen liegt hier vor, neben, unter und über uns. Was für ein unbeschreiblicher Anblick. Ich habe Gänsehaut. Riesige Felszacken, Gletscher, grüne Wiesen, nackte Steinriesen…ein Adler fliegt an uns vorbei. Ich muss mich selbst kneifen, um zu merken, dass das hier kein Traum, sondern Wirklichkeit ist. Dem Himmel so nah…
So schön, so überwältigend, so gigantisch. Gewaltig, imposant, furchteinflößend. Diese Berge wirken magisch, ursprünglich und unantastbar. Wer einmal von ihnen in den Bann gezogen wurde, kennt die Freiheit und Grenzenlosigkeit, die man dort verspürt. Es scheint, als wäre man von allen Problemen und Sorgen befreit. Dieser Moment berührt alle Sinne. Es ist ein Wechselspiel der verschiedenen Farben, von Licht und Schatten.
Ich kann nicht still stehen, laufe herum, um wirklich alles zu sehen. Wieder fliegt ein Adler vorbei. Fasziniert schaue ich ihm nach. Er schwebt. Kein einziger Flügelschlag. Er lässt sich vom Wind tragen und gleitet majestätisch auf Augenhöhe vorbei. Was für ein magischer Moment…noch lange schaue ich ihm hinterher. Ein kleiner, schmaler Weg führt noch etwas weiter hinauf. Während Marc sich auf einer Sonnenterasse in einen der Liegestühle fallen lässt und einfach nur die Aussicht genießt, bin ich neugierig, wie weit dieser kleine Weg mich noch nach oben bringen würde.
Die Sonne scheint, ein angenehm kühles Lüftchen geht und ich bin umringt von Giganten. Ich folge dem schmalen Pfad und bestaune mit großen Augen die schroffe und kahle Berglandschaft. Immer wieder fällt der Weg steil ab. Der Blick fällt nur noch in menschenverlassene Natur.
So stehe ich nach kurzer Zeit am Gipfelkreuz und habe fast Tränen der Rührung in den Augen. Ich bin absolut überwältigt. Keine Worte könnten beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Am Horizont kann ich den Col du Granon erkennen. Da war ich vorgestern. Und da hinten, da müsste der Col d`Izoard sein. Da geht’s morgen hin.
Bestimmt 30 Minuten stehe ich hier und staune in die Gegend. Kann mich gar nicht satt sehen und versuche, alles aufzusaugen. Völlig geflasht klettere ich dann wieder zum Plateau herunter und setze mich zu Marc auf die Sonnenterrasse. Was kann es Schöneres geben, als hier – in absoluter Stille – im Liegestuhl zu liegen und die umliegenden Felsen zu bestaunen? Wir genießen einfach das hier und jetzt. Dann durchbricht ein knurren die herrliche Ruhe hier oben. Und da, schon wieder knurrt es…oh je, das ist mein Bauch, denn ich habe jetzt richtig Hunger. Klar, wir haben heute Morgen gefrühstückt und sind seitdem unterwegs. Also machen wir uns auf, so schnell wie möglich wieder nach Briançon zu kommen und uns die hungrigen Bäuche vollzuschlagen. Was für ein fantastischer Tag – wenn er auch nicht ganz so ruhig war, wie ein Ruhetag eigentlich hätte sein sollen.
So sitzen wir nun im Zentrum von Briançon und lassen uns köstliche Schweinereien schmecken. Herrlich 😊.
Der letzte Tag - Col d´Izoard
Eine Super Radtour durch eine bizarre Berg-Landschaft. Das ist die Kurzform dieses Kapitels. Aber natürlich war es noch mehr. Viel mehr…
Das Schöne an den französischen Alpen ist, dass jeder Anstieg seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Charme und vor allem seine eigene Herausforderung hat. Genau hier sticht der Col d’Izoard besonders hervor. Für mich ist er einer der schönsten Pässe der Alpen überhaupt. Diese Einsamkeit, diese Wildheit, diese Natur, diese Ausblicke, graue Felszacken, dunkler Wald. Vom Verkehr weitgehend verschont, weil es eine deutlich schnellere Alternative durchs Tal gibt. Dennoch ist die Strecke durchgängig asphaltiert und in gutem Zustand.
Bei meinem letzten Besuch hier war er der Scharfrichter. Der Berg, der mich (fast) in die Knie gezwungen hatte. An dem ich das Gefühl hatte, gegen Windmühlen zu kämpfen. An dem ich meinen ersten und – zum Glück – bisher einzigen richtigen Hungerast hatte. An dem ich gelitten, geflucht, geheult und mich zum Schluss doch hochgequält habe. Ich erinnere mich an einen rabenschwarzen Tag auf dem Rad. An Schmerz, Nässe und Kälte. An Leid und Selbstmitleid. „Alter, was machen wir hier?“, fragte ich mich damals mitten im Aufstieg. Meine Antwort habe ich von dem Philosophen Peter Sloterdijk. Er sagte mal:
„Gebirge kritisiert man nicht, man besteigt sie oder lässt es bleiben.“
Dieses Mal aber weiß ich, was mich erwartet. Dieses Mal bin ich vorbereitet. Dieses Mal werde ich ihn in die Knie zwingen, ihn platt bügeln und besiegen. Ich habe genug gegessen und getrunken. Dieses Mal werde ich diesen Anstieg zelebrieren und nicht nur stumpf die Höhenmeter wegtreten. Dieses Mal werde ich triumphieren und nicht nur einfach ankommen. Dieses Mal wird man meine Jubelschreie bis ins Tal hören.
Dieses Mal wird’s geil!
Versprochen!
Wir haben uns einen schönen Rundkurs gesteckt. Von Briançon aus geht’s in Richtung Guillestre und dann über den Col d`Izoard zurück nach Briançon. Wir haben uns an den Schildern der Veloroute „La Boucle d’Izoard“ orientiert und sind zunächst auf einer großen Hauptstraße in Richtung Süden unterwegs. Und wir können unser Glück kaum fassen, denn es geht bergab. Nichts Wildes, aber kilometerlang ganz seicht mit 2-3 Prozent bergab. Was für eine Wohltat.
Wir haben frischen Wind im Rücken. Moment mal, denke ich, Moment! Wind im Rücken? Im R-Ü-C-K-E-N? Ich prüfe es noch einmal. Und tatsächlich, eine leichte Brise, nicht viel, nicht stark, aber ich kann sie spüren - sie weht von hinten durch meinen Helm. Rückenwind? Rückenwind, hier, heute, für mich? Das, das gibt es doch gar nicht, nein, denke ich, nein, das glaube ich nicht! Hier gibt es keinen Rückenwind! Hier ist nichts, was es dir leichter macht! Hier hält die keiner die Tür auf, bittet dich hinein, hier macht die keiner die Steigungen weniger steil, hier bügelt keiner die Berge glatt und schon gar nicht bläst dir hier einer von hinten den Wind um die Ohren! Nein, nein und nochmals nein. Aber da stehen 37 km/h auf meinem Bike-Computer. Und langsam fange ich an, es zu glauben. Wir haben wirklich Rückenwind. Wow!
Und so rollen wir schön entspannt durch den schon wieder richtig heißen Vormittag. Ich wundere mich und denke noch: Wo ist der Haken?, da bäumt sich vor uns plötzlich die Fahrbahn auf. Wir erreichen Guillestre.
Relativ kompromisslos steigt hier die Straße auf kurzer Strecke zweistellig in die Höhe. Jetzt heißt es beißen. Vorbei die schönen entspannten Kilometer. Jetzt beginnt die Arbeit. Also fix die Ärmel hochgekrempelt und hoch da. Alter Schwede, ist das krass. Nur 1,4 Kilometer lang, aber mit 9% im Schnitt geht’s in den Ort hinein. Im Zeitlupentempo ächzen wir nach oben. Ich fühle mich irgendwie an die belgischen Hellingen erinnert. Schrecklich und wunderbar zugleich, brauche für dieses Stück fast 10 Minuten…Oben angekommen stehen wir nebeneinander und schauen vor uns in ein zauberhaftes Tal. Überwältigend schön. Und das Beste? Dort, wo man sich hochgequält hat, geht’s natürlich auf der anderen Seite auch wieder bergab.
Es folgt eine wunderbare Abfahrt. Nicht sehr steil, sondern sich ruhig bergab schlängelnd. Wir rauschen im Paarflug an den Felsen entlang. Zwischen Guillestre und Chateau-Queyras durchquert man die Combe du Queyras, eine atemberaubend schöne Schlucht. Die gesamte Südseite des Passes liegt im einem Naturpark. Zwei Drittel der Route verläuft die breite Straße am Talgrund neben dem Guil, einem türkisblauem Fluss, der bei diesen Temperaturen förmlich dazu einlädt, unsere Füße zu kühlen.
Langsam rücken dann auch die Berge näher, das Tal, durch das wir fahren, wird immer enger. Immer grandioser wird das Panorama. Die Schlucht, in der neben uns der Fluss fließt, wird immer schmaler, die Berge und Felswände immer höher. Selten nur dringt die brennend heiße Sonne direkt auf unsere Haut – der Schatten tut richtig gut. Wir kurven die engen Schleifen ab und schlängeln uns so auf teilweise tief in überhängende Steinwände gefrästen Straßen durch die Natur. Nur selten kommen uns Autos entgegen. Leicht geht es bergan, aber fast nicht zu spüren. Würde mir mein Garmin nicht anzeigen, dass wir stetig an Höhe gewinnen, ich würde es nicht merken. Ein leichter Rückenwind schiebt uns komfortabel an. Perfekter Asphalt lässt es gut rollen. Schluchtenfeeling pur. Wie aus dem Bilderbuch. Fluss, Straße, Steilwände und nicht zu vergessen: Kurven ohne Ende. Ich kann mich gar nicht satt sehen.
Majestätisch ragen Berge neben uns steil in die Höhe. Tief eingeschnitten das Tal. Und noch immer: Ab und zu geht es seicht bergan. Seicht bergab. Es ist heiß. Brütend heiß. Stehenzubleiben bedeutet, sich der vollkommenen Windstille auszusetzen. Das ist, wie sich in einen Umluftherd zu begeben. Nur ohne Umluft. Ich kann den Schweiß verdampfen sehen. Selbst das ununterbrochene Zirpen der Grillen scheint angestrengt zu sein. Hier mögen es in der Sonne gut und gerne 45 Grad sein. Man sieht das Flimmern der Hitze auf dem Asphalt. Ich trete und trete und trete mich in heiße Trance.
Dann ist sie endlich da. Die lang ersehnte Linkskurve. Jetzt geht’s endlich richtig hoch. Jetzt geht’s endlich in den Izoard. Ich jubele still in mich hinein. Meter um Meter geht es wieder nach oben. Ich heiße die Steigung willkommen. Wieder knackt es mächtig im Gebälk, wieder strenge ich mich an - nach dem langen Kurbeln durch die flachen Täler tut mir die Langsamkeit in der Vertikalen richtig gut.
Es geht zunächst durch dichten Wald, was angesichts der hohen Temperaturen sehr angenehm ist. Konnte ich unten am Fuße noch locker pedalieren, muss ich jetzt schon den Lenker etwas fester halten, muss mehr Energie in die Pedale bringen. Wie in Trance trete ich mich Rampe um Rampe nach oben. Noch scheinen die Prozente hier nicht im zweistelligen Bereich zu liegen, aber immer wieder, vor allem in den engen Kurven zur nächsten Rampe, zieht es dermaßen an, dass, wer hier nicht rechtzeitig aus dem Sattel geht oder Schwung holt, unweigerlich stecken bleiben muss. Drehe ich mich kurz um, liegt die Strecke nicht hinter - sondern unter mir.
Plötzlich sind wir aus dem Wald raus. Die Straße geht unbeirrt weiter in die Höhe. Aber die Kiefern hören auf. Ich atme erleichtert auf, ich richte mich auf dem Sattel auf, recke und strecke mich, fahre einige Meter freihändig, trinke tiefe Schlucke von meinem mittlerweile heißen Isodrink und blicke mich um. Hinter mir das Tal, vor mir wird der Izoard von grünen Grasstoppeln bewachsen und neben mir ... geht es ganz schön tief nach unten! Die Aussicht ist grandios. Ich atme die etwas kühlere Luft hier oben und bin beseelt. Ich freue mich über das Hier und Jetzt, denn es liegen noch einige hunderte Höhenmeter vor mir. Schwer atmend und breit grinsend kurbele ich weiter bergan. Die Steigung genieße ich - es ist wie nach Hause kommen, wie, als würde ich das schon mein Leben lang machen, als hätte ich niemals etwas anderes gemacht, als nach oben zu fahren. Mich stören nicht die 10 km/h, mit denen ich hier Kilometer für Kilometer entlang krieche. Es ist ein bisschen wie die Entdeckung der Langsamkeit. Die Essenz der Vertikalen. Ein Traum.
Das Tal unter mir entfernt sich zusehends, ich gewinne mit jeder Kubelumdrehung, so scheint es, immer mehr und immer schneller Abstand zur Welt da unten. Mir läuft der Schweiß in Strömen, es ist anstrengend, aber ich stecke voller Endorphine, Freude ist es, die da in meinen Waden brennt, keine Ermüdung, ein Lächeln ist es, dass meine Lippen umspielt, es sind Freudenschreie, die mein Atem hervor presst. Ich schaue auf meinen Garmin. 14%. 8 Km/h, ich bin voll am Anschlag, trete wie ein Irrer in die Pedale. Und die Profis? Die fahren hier fast dreimal so schnell. Man erkennt, dass das, was diese Männer leisten, alles übersteigt, was Normalsterbliche begreifen können.
Links neben mir türmen sich die Berge auf, ein großartiger Anblick, wie sich die Wolken und Hochnebelbänke an den Hängen brechen. Klein kommt man sich hier vor, klein und unglaublich langsam. Klar ist die Luft hier oben - ein Paradies. Perfektes Radwetter. Wo sind eigentlich die Filmkameras, wenn man sie braucht? Her mit Euch, hier gibt es epische Bilder, die Ihr filmen könntet! Über mir nur blauer Himmel. Grüne, braune und graue Kuppen im Vordergrund, ruppige, schneebedeckte Felsen im Hintergrund. Die größte Theaterkulisse, wahrlich, die beste Kulisse, die sie sich haben ausdenken könnten, um ihr Stück, Epos vom Helden der Landstraße aufzuführen.
Dann und wann gehe ich in den Wiegetritt, schalte einen Gang schwerer und versuche, ruhig, mich zügelnd beständig die Steigung hinauf zu wuchten. Minutenlang kann ich oft vollkommen allein fahren. Verlassen, ein Arbeiter in der Steigung, allein, über allem thronend, allein, Herrscher der Berge.
Ich habe den Berg und diese sich hinauf windende Straße für mich allein, denn was ich nicht sehe, sind andere Rennradfahrer. Dabei sind Wetter und Berg geradezu in Paradelaune. Würden sie hier heute ein Profirennen live auf Eurosport übertragen, es gäbe die schönsten Bilder!
Es ist heiß, die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel herab und zerbrutzelt mich, aber meine Beine fühlen sich prima an - ich merke es: Heute ist ein Heldentag. Die Gedanken driften weg. Der Schmerz ist weg. Schwebezustand. Irgendwie fühlt es sich unwirklich an. Als würde ich mich selbst von außen betrachten. Die Kette surrt leise vor sich hin, ein paar Vögel sind zu hören und um mich herum ist es unbeschreiblich schön. Meine Ruhe. Mein Glück. Tour de France-Graffiti erinnern mich an die sportliche Geschichte dieses Aufstiegs. Dieser Pass steht seit Anbeginn der Großen Schleife auf dem Programm. Vertrautes Terrain. Irgendwie.
Wieder wird es steil und steiler. Wieder komme ich kaum vorwärts. Wieder ist es ein Kampf um jede Kurbelumdrehung. Hier beginnt das Leiden. Wegen des Anstiegs – aber vor allem wegen der Hitze. Jeder noch so kleine Schluck der warmen Brühe aus meinen Trinkflaschen verdunstet, bevor er im Magen ankommt. Ich kämpfe mich, wie in Zeitlupe, Meter für Meter nach oben. Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein. Wie lange sind wir wohl schon unterwegs? Keine Ahnung, ist auch egal, denn ich möchte gerade nirgends wo anders sein.
Irgendwann, ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren, strample ich mich über die Baumgrenze und sehe nun die sich hangaufwärts schlängelnde Straße. Langsam schraube ich mich die Höhe hinauf. Neben mir tauchen immer mehr kahle Felskuppen auf, überwältigend schön. Das dicht besiedelte Tal, aus dem wir gerade gekommen sind, weicht zurück hinter einer menschenleeren Kulisse. Die Landschaft ist surreal. Das Brennen in meinen Oberschenkeln allerdings ist sehr real.
Ist man im unteren Teil noch im lichten Kiefernwald unterwegs, bietet sich weiter oben eine grandiose Serpentinenstrecke in zerklüfteter und wilder Felslandschaft. Und siehe da, das Kurbeln hat sich gelohnt, mir schwellt die Brust. Denn hinter einer seichten Kurve sehe ich es dann endlich: die Casse Déserte, eine wüstenartige Verwitterungslandschaft. Es wirkt wie aus "Herr der Ringe" oder "Star Wars" - wie aus irgendwoher, nur nicht von dieser Erde. Dieser Anblick ist einfach beeindruckend und ich weiß nun, dass es bis zum Gipfel nicht mehr weit ist. Doch zunächst muss ich mich einige Serpentinen hinaufkämpfen. Die Landschaft erinnert mich an die Mondlandschaft. Wie herrlich, wie perfekt, wie sensationell diese Kulisse! Die Straße scheint im Himmel zu verschwinden. Steil schraubt sie sich mit zweistelligen Prozenten nach oben. Und ich bin jetzt so in Trance, dass ich nichts dagegen habe.
Ich drehe mich kurz um, sehe voller Stolz das bereits geschaffte. Da, da hinten, diese kleine Straße, die sich da so idyllisch schlängelt, aber mitunter so brutal in den Felsen gehauen wurde, da, das alles habe ich bereits erobert, geschafft, gewonnen! Dann trete ich rein, beschleunige - zumindest so gut, wie es bei gefühlten 40 Grad eben geht - kurbele und schalte nach oben, fliege um die Kurven und rausche am Abgrund entlang und fühle mich wie der König der Welt. Unter mir surren die Carbonlaufräder, heiße Luft strömt durch den Helm - was kann es Schöneres geben? Ich lächle unter meinem Schweißgesicht.
Wieder legt der Izoard ein, zwei Prozentchen drauf. Die Legende des Berges, sein HC-Status begründen sich unter anderem auch damit, dass, anders als bei anderen Bergen, der Radfahrer vom Berg nicht belohnt wird. Je weiter man nach oben kommt, desto steiler wird er. Je mehr man ihm an Höhenmetern abnimmt, desto mehr Prozente packt er drauf. Und jetzt merke ich es: Aus 12 km/h sind 9 geworden. Es knackt verdächtig im Gebälk meines Tretlagers: Untrügliches Zeichen dafür, dass da richtig viel Watt ins Carbon gedrückt werden. Leck mich am Arsch ist das heiß! Meine Waden ersticken unter der Schicht Sonnencreme, oben auf, wie Perlen eine dicke Schicht milchig-weißen Schweißes, immer wieder unterbrochen von feinen schwarzen Staubpartikeln von Straße und Auspuff. Und jetzt fängt es auch an, richtig weh zu tun.
Als ich früher die Tour de France im Fernsehen geschaut habe, da dachte ich immer, wie bekloppt muss man eigentlich sein, sich derartige Berge hoch zu quälen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich irgendwann mal selbst einer dieser Bekloppten sein würde, die sich im Schneckentempo Kurve um Kurve an einen Anstieg abmühen. Warum ist das eigentlich so schön, im Stillen zu leiden, während man sich allein eine Passstraße hochquält? Wahrscheinlich, weil die Berge uns zwingen, mal inne zu halten. Sich auf sich selbst zu besinnen. Sich selbst zu fühlen. Ohne eine App, die einem sagt, was los ist. Ohne Hilfsmittel. Einfach pur. Ich muss – gezwungenermaßen – alles mit mir selbst und dem Berg ausmachen. Bergauf zu fahren ist ein meditatives Abenteuer. Es macht den Kopf frei. Ich fühle mich dann so klein, wenn ich diese Berge sehe. Gewaltig, imposant, aber auch furchteinflößend – Berge wirken magisch, ursprünglich und unantastbar. Aber wenn ich dann am Gipfel angekommen bin, dann fühle ich mich riesengroß, weil ich es (wieder mal) geschafft habe. Das fasziniert mich und weckt das Verlangen, die Berge zu erobern, koste es, was es wolle 😊.
Links neben mir tut sich nun eine mächtige Schlucht auf. Wir haben die meisten Serpentinen im unteren Bereich hinter uns. Nun gilt es, fast schnurstracks geradeaus entlang dieser filmreifen Kulisse zu treten. Die finalen Kilometer. Ich gehe aus dem Sattel und beschleunige. Ja, es geht noch. Die Beine machen mit. Aber sag mal, war das hier beim letzten Mal auch so steil? Krass.
Eine Kehre. Dann die nächste. Treten, weiter treten. Im niedrigsten Gang langsam nach oben. Meter für Meter. Die Lunge schreit. Die Muskeln brennen. Trinken. Ein Blick nach oben. Der Pass wartet geduldig. Es folgen die beiden letzten Kurven. Hier zieht es noch einmal hart an. Die Straße schickt sich an, wieder zur senkrechten Mauer zu werden. Bevor ich Ausblick vom Gipfel genießen kann, kämpfe ich mich eine immer absurder ansteigende, immer enger werdende, kleine Landstraße hinauf. Als ich die erste Kurve durchfahre, kann ich einige dutzende Meter unter mir die Rampe von eben erkennen. Ich blicke herab auf das "Vorhin". Auch diese Poesie liebe ich so am Bergfahren - das "Vorhin" und das "Gleich". Ich kann es sehen. Das Eine erfüllt mich mit Stolz. Das Andere mit Ehrfurcht.
Die letzte Kurve genieße ich - die letzten Meter hinauf zum Gipfel, die letzten Meter in Ruhe. Die letzten Meter allein. Dann rolle ich über die Linie.
„Vive la France!“ jubele ich.
Col d´Izoard, es war mir ein wunderschönes Vergnügen.
Ich stehe vor dem riesigen Obelisken und grinse in den azurblauen Himmel. Das Siegesschild grüßt mich. Wieder mal auf dem Dach des Berges, wieder mal ganz oben, wieder mal die Steigung besiegt, die Vertikale gerockt - es wird zur Sucht, ja, zur Sucht.
Jawoll, ich hab dich geknackt, du oller Izoard.
Alle Anstrengung vergessen. Was könnte man jetzt alles sagen, Worte können diesen Moment, die gesammelten Eindrücke, die einzigartigen Augenblicke und die Gedanken kaum beschreiben. Am Ende wäre vieles gesagt und doch nicht alles erzählt. Es ist einfach ein wunderbares Gefühl – ein geiles Gefühl, ganz oben auf diesem Pass angekommen zu sein. Ein wundervoller Berg. Er war gnädig zu mir. Hat mich umarmt, ja, fast eingeladen. Das Wetter spielte mir in die Hände: Hitze, leichtes Lüftchen - perfekt, für meine Betriebstemperatur. Perfekt für niedrige Gänge und hohe Drehzahlen. Ich habe hier alle überholt, die vor mir lagen - niemand kam von hinten. Niemand ließ mich stehen.
Und dann kommt Marc.
Er sieht mich und geht aus dem Sattel und fliegt förmlich die letzten Steigungsmeter nach oben. Auch ihm steht dieses einmalige Grinsen im Gesicht. Es ist diese Zufriedenheit, dieses unermessliche Glück, diese Gewissheit, etwas geschafft zu haben, das ein Großteil der Leute da draußen nicht schaffen würde. Vielleicht noch nicht mal probieren würde. Er hatte im Vorfeld unserer Reise gehadert, gezaudert und gezweifelt. Aber hier und jetzt fällt alles ab. Alle Zweifel sind verschwunden. Pure Freude, Stolz und ganz viel Erleichterung machen sich breit. Wir haben es gemacht. Wir haben uns der Vertikalen gestellt. Und sie gemeistert. Marc grinst und ich freue mich mit ihm - freue mich über uns, unseren Trip und dieses herrliche Wetter. Er kommt zu mir herüber:
"Zeit fürs Siegerfoto."
Recht hat er.
Wir stehen einige Minuten da und lassen uns die Sonne auf die Nase scheinen. Ich spüre schon das Kribbeln, die Vorfreude, auf das, was nun folgt. Die Abfahrt. Bis Briançon geht’s jetzt nur noch runter. Also los – Abfahrt 😊. Und so stürzen wir uns in die Serpentinen. Es geht fast 15 Kilometer steil hinab. Rasant schießen wir auf den Geraden bergab, Adrenalin schießt durch die Adern. Die Straßen sind trocken, was die Abfahrt richtig geil macht, der kalte Fahrtwind der schnellen Reise ins Tal wird von der immer wärmer scheinenden Sonne gewärmt - und so ziehen sich die Kilometer für mich wie zuckersüßer rosaroter Kaugummi in die Länge. Grünes, sattes, wunderschönes Tal. Es ist eine Sinfonie. Es ist wunderschön. Marc vorne weg. Ich lasse 200, 300 Meter Abstand zu ihm und lege mich dann genüsslich in die Kurven. Kalt wird es am Oberkörper, wenn der Fahrtwind von 60, 65 km/h die wärmende Sonne übertrumpft. Wieder und wieder bremse ich mich hart in die engen, sehr steilen Kurven hinein, dann langsam loslassen, die Augen zum Mittelpunkt, dann vorauswandern lassen - wie von Zauberhand fährt das Rad dahin, wo ich hinsehe. Es fasziniert mich immer wieder. Trotzdem, ein guter Abfahrer bin ich längst nicht. Kaum mehr als 70 km/h lasse ich zu. Weit weg von den Geschwindigkeiten, von denen andere Hobbyfahrer berichten. Und Welten entfernt von den 90, 100 km/h, die die Profis hier bei der Tour de France erreichen.
Nach 20 Minuten sind wir unten. Und angekommen.
Zurück in unserem Appartement schlagen wir uns die Bäuche voll und schwärmen über diesen fantastischen Tag. Wir sitzen da und schnacken. Rekapitulieren noch einmal die vergangenen Tage. 5 Etappen. 8 wunderbare Berge. So viele Eindrücke, so viele Erlebnisse, so viele unterschiedliche Landschaften, so viele Menschen, so viele tolle Begebenheiten und noch so viel mehr! Legende und Ruhm der Tour de France in Massen eingesogen.
Unser Sommermärchen, es endet heute. Merci France, es war ein wundervoller Trip!
Ich mache es mir gemütlich, massiere Creme in meine Beine, denn die haben heute wirklich ganze Arbeit geleistet. Glücklich und zufrieden gehe ich ins Bett, schlafe schnell ein und träume. Vom Izoard, von Alpe d´Huez, vom Granon, vom Galibier…träume unser Sommermärchen, für immer in meinen Erinnerungen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La Vuelta 2022 Hollanda
Die neben der Tour de France und dem Giro d´Italia dritte große dreiwöchige Landesrundfahrt, die Vuelta Espana, startete im August 2022 in Utrecht in den Niederlanden. Was für eine tolle Möglichkeit, mal wieder eine Grand Tour live zu sehen. Mein Urlaubskonto zeigte noch ein paar freie Tage an und so startete ich gemeinsam mit meinem Bestfriend Marc in Richtung Utrecht, um vier Tage Vuelta Espana Hollanda live zu erleben.
Und wie nicht anders zu erwarten, wurde es großartig.
Eine solche Rundfahrt in einem Land starten zu lassen, in welchem die kleinen Kinder mit dem Fahrrad auf die Welt kommen, ist natürlich ein genialer Schachzug. Um die Stimmung brauchten sich die Organisatoren nun wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Denn wenn eine Nation Radsportverrückt ist, dass sind es die Niederländer. Und so hatten wir fantastische vier Tage lang Gelegenheit, eine einzigartige Atmosphäre in uns aufsaugen zu können.
Los ging es am 18.08...
Noch vor der eigentlichen Teampräsentation schauten wir am Teamhotel unseres Lieblingsfahrers Alex Kirsch vorbei und waren glücklich, ihn unmittelbar nach seinem Vormittagstraining dort gut gelaunt anzutreffen. Da durfte das obligatorische Selfie natürlich nicht fehlen...
Das war schon mal ein perfekter Einstieg.
Und dann folgte eine Teampräsentation, wie ich sie noch nicht erlebt hatte. Nach dem Vorstellen der Teams auf der großen Bühne ging es für die Fahrer auf kleine Boote, mit denen sie an Tausenden Fans vorbei über die Utrechtsche Vecht geschippert wurden. Ich denke mal, dass das nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Fahrer ein ganz besonderes Erlebnis gewesen ist.
Laut, lauter, Utrecht - so hätte man es nennen können, denn was die Holländer da für ein Feuerwerk abbrannten, das war der pure Wahnsinn. Nicht nur die Fans links und rechts am Ufer machten richtig viel Lärm, sondern auch auf jeder Brücke - und davon gab es sehr viele - standen kleine Bands und spielten Livemusik. Nicht immer sehr gut, aber auf jeden Fall laut und lustig. Dazu waren in den Fenstern der angrenzenden Häuser große Lautsprecherboxen aufgebaut, aus denen natürlich auch laute Partymucke dröhnte. Verrückt, aber sehr sympatisch. Und es war wirklich alles auf der Straße, jung und alt, egal ob Radsportfan oder nicht, einfach alle feierten mit.
Und wir? Nun, wir hatten uns genau dort platziert, wo die Fahrer die Boote verließen und wieder an Land kamen. Einer nach dem anderen musste so an uns vorbei und ich kam mit dem Knipsen der Selfies kaum noch hinterher. Herrlich, wie entspannt die Athleten diese Zeremonie mitmachten und sich ablichten ließen. Und so sah das dann aus...
Roglic, Ackermann, Froome, Valverde, Carapaz und viele, viele andere ließen sich bereitwillig vom Selfieking fotografieren. Wer sehen will, wer mir da alles vor die Kamera gelaufen ist, der schaut am besten in die Galerie "Vuelta 2022".
Und als dann der letzte Fahrer (Primoz Roglic) an uns vorbei und in den Teambus gestiegen war, da endete die Teampräsentation. Nicht enden wollten allerdings die Feierlichkeiten, denn viele Leute feierten ab da sich einfach selbst. Wir machten uns derweil auf in Richtung Hotel, denn am nächsten Tag sollte der offizielle Start der Rundfahrt mit einem Mannschaftszeitfahren erfolgen. Da wollten wir natürlich fit und ausgeruht sein...
Tag 2 - Start der Vuelta
Mannschaftszeitfahren...der Scharfrichter des Radsports. Etwas, wovor selbst gestandene Profis Respekt und teilweise sogar Angst haben. Warum? Na weil alle acht Fahrer einer Mannschaft als Team unterwegs sein müssen, als Einheit. Sozusagen "Einer für alle und alle für einen". Es ist eine spektakuläre Disziplin, weil es die Harmonie in der Mannschaft zeigt und wie sich die Leute füreinander aufopfern, um gemeinsam etwas zu erreichen. Die Königsdisziplin im Radsport: Das Mannschaftszeitfahren ist eine komplexe Mischung aus individueller Spitzenleistung und purem Teamwork - die perfekte Choreografie auf dem Rennrad. Nur wer einstudierte Abläufe in Höchstgeschwindigkeit ideal auf die Straße bringt, schneidet erfolgreich ab. Lange gab es diese Disziplin nicht mehr bei einer großen Rundfahrt, aber die Vuelta hatte das Mannschaftszeitfahren auf dem Plan. Was für ein Spektakel. Die Teams rasten mit einem unvorstellbaren Speed an uns vorbei. Die Jungs von Jumbo Visma absolvierten die 23,3 Km in einer Zeit von 24,40 Minuten! Auf einem Stadtkurs! Unglaublich. Die Lautstärke um uns herum war enorm. Es wurde auf die Bandenwerbung gehauen, die Fahrer lautstark angefeuert, regelrecht angeschrien. Wir waren im Zentrum eines Orkans, es gab kein Entrinnen. Wollten wir auch gar nicht. Ein Orkan an Jubel, Geschrei, Anfeuerungsrufen und Ekstase echter Radsport-Fans. Was für eine Atmosphäre, die wir da aufsaugten. Völlig geflasht ging es danach für uns zurück Richtung Auto.
Tag 3 - 1. Etappe
Das war eigentlich unser stressigster Tag, denn obwohl der Start in ´s-Hertogenbosch und somit gar nicht weit von unserer Unterkunft erfolgte, hatten wir uns selbst ein richtig straffes Programm gestrickt. Zunächst erstmal beim örtlichen Bäcker an der Auslage der schweinischen Leckereien vorbei (naja, zumindest fast :-)) und ein ordentliches Frühstück genossen, ging es sodann zum Startort der Etappe. Hier dann die schon obligatorische Frage: Wo soll man sich hinstellen, um so viel wie möglich zu sehen? Wir entscheiden uns für eine recht ruhige Nebenstraße und landeten damit einen Volltreffer. Das gesamte Feld rollte noch neutralisiert, d.h. vor dem "scharfen" Start langsam an uns vorbei und wir hatten so die Gelegenheit, ausgiebig und in aller Ruhe zu fotografieren. Nachdem das Feld vorbei war, schwangen wir uns wieder ins Auto und fuhren an die Strecke, um dann dort nochaml das Fahrerfeld - nun im ordentlichen Renntempo - an uns vorbeifliegen zu lassen. Und dann abermals ins Auto und ab zum Ziel nach Utrecht. Tja und dort trafen wir dann auf Bri & Mad, die sich von uns haben anstecken lassen und kurzfristig nach Utrecht gekommen waren. Das war ein wunderbar herzliches Wiedersehen, denn irgendwie schafen wir es, uns immer mal wieder bei tollen Radsportevents über die Füße zu laufen. Das war schon so beim Tourstart seinerzeit in Düsseldorf oder bei CX Weltcup in Hoogerheide...
Tag 4 - 2. Etappe
Heute mal ganz in Ruhe und völlig streßfrei. Also postierten wir uns an der Verpflegungszone an der Strecke und warteten. Dann fingen plötzlich die Ordner an, den Weg freizumachen. Alle weg von der Straße. Die Teams postierten ihre Helfer mit den Verpflegungsbeuteln an der Strecke. Der Auto-Korso kommt. Begleitmotorräder, Jury-und Teamfahrzeuge kündigen das nahe Peloton an. Eine irrsinnig lange Karawane ist das. Der Helikopter schwebt über unseren Köpfen. Die Show kann beginnen. Und dann kommen die Profis auch schon die schmale Straße hochgeschossen.
Es geht alles so schnell. Nur Zentimeter von meinen Füßen entfernt rauscht das Feld an uns vorüber. Die Helfer halten die Beutel, die Fahrer greifen danach, ohne auch nur im Ansatz ihr Tempo zu reduzieren. Habt ihr mal versucht, mit 50 km/h etwas zu greifen? Ich hätte wahrscheinlich noch nicht einmal meinen Helfer rechtzeitig gesehen. Wahnsinn, was für ein Tempo! Komplett verrückt und total anders, als wir es jemals könnten. Und wusch, waren sie am Horizont verschwunden.
Ich hatte Gänsehaut. Dieser Sound, wenn 180 Fahrer an einen vorbei rauschen, viele Freiläufe surren und Carbonlaufräder bollern. Dazu die Fahrzeuge und der Helikopter...wirklich Gänsehautfeeling pur.
Und damit war das Erlebnis Vuelta 2022 für uns erstmal Geschichte. Was bleibt? Nun, zunächst einmal diese grandiose Begeisterung der Niederländer für den Radsport. Selbst hier an der Strecke , irgendwo im nirgendwo, standen hunderte Zuschauer und feuerten die Fahrer lautstark an. Dann faszinierte mich diese herrliche Unaufgeregtheit, mit der die Strecken abgesperrt und gesichert wurden. Die Rücksicht der übrigen Verkehrsteilnehmer für diese Großveranstaltung und die unvorstellbare Menge an Polizeimotorrädern, die im Einsatz vor und hinter dem Feld waren.
Wir durften (wieder einmal) herzliche Gastfreundschaft genießen, leckere Pommes futtern und verdammt guten Radsport hautnah erleben. Das war definitiv nicht unsere letzte Reise ins Nachbarland.
Flandrien Challenge 2022
Das war doch mal ein Ziel…ich werde ein echter Flandrien.
Marc und ich machten uns auf den Weg nach Belgien. Warum? Nun ich hatte auf der Seite des flandrischen Fremdenverkehrsvereins eine verführerische Aufforderung gelesen:
„Absolviere innerhalb von 72 Stunden die 59 Abschnitte mit den berühmtesten Berg- und Kopfsteinpflasterpassagen Flanderns und dein Name wird in der Hall of Fame des Centrum Ronde van Vlaanderen in Stein gemeißelt. Wenn Sie das schaffen, machen wir Sie zur Legende: mit Ihrem eigenen personalisierten Stein auf der Ruhmeswand des Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.“
Na, das war doch genau das Richtige für Papas Jüngsten 😊. Jungs, ihr könnt schonmal meinen Namen auf den Stein hämmern, ich bin unterwegs…
Hier könnt ihr lesen, wie wir die Achterbahnfahrt durch die flämischen Ardennen erlebten, um bei „Bikes, Bier & Fritten“ einmal in die Faszination Radsport in Flandern einzutauchen. Natürlich habe ich hier nicht die gesamten drei Tage und alle Segmente beschrieben, aber ich denke, ihr bekommt einen ganz guten Einblick in die Flandrien Challenge von Marc und mir.
Flandernrundfahrt stand also auf dem Programm. Aufgeteilt in drei Tage. Drei Tage Spaß mit dem besten Freund an meiner Seite, was kann es schöneres geben?
Was für eine Vorfreude, den flämischen Boden unter die Räder zu nehmen, denn die Flandern-Rundfahrt ist schließlich eines der Monumente des Radsports. Koppenberg, Paterberg, Muur, Oude Kwaremont…das klingt wie Musik in den Ohren. Dazu noch das aus dem Fernsehen bekannte Kopfsteinpflaster. Ich spürte es schon...es würden Heldentage werden.
Eins vorneweg: Ich hatte keine Ahnung, was es heißt, flämisches Kopfsteinpflaster zu fahren, bis ich hierher zur Ronde gekommen bin. Sicher, manche Strecken in Deutschland haben auch immer mal wieder Pflastersteine im Programm. Aber das alles ist nichts, wirklich gar nichts gegen das, was die Belgier da im Boden Flanderns versenkt haben!
"Au weia, das wird richtig weh tun!", freute ich mich schon und dachte gleichzeitig: Das hält das Material nicht aus! Niemals!!!
Meine erste Passage war keine eintausend Meter lang, das Rad sprang von Stein zu Stein. Oder in die Zwischenräume. Lücken, die so übel waren, dass man meinte, darin zu verschwinden. Und als ich am Ende wieder Asphalt unter den Reifen hatte, musste ich meinen Helm richten, die Knochen sortieren, die Augen geradestellen und atmen. Einfach atmen. Mein Puls blieb bei 200.
Alter Schwede, was war das denn? Ich war schockiert und fasziniert, ganz aus dem Häuschen.
Die Steine waren groß, nur grob behauen, nicht abgerundet wie in Deutschland und zwischen den einzelnen Pflastersteinen taten sich wahre Gräben auf. Mir flog mir fast die Kinnlade vom Schädel. Ich umklammerte meinen Lenker, als die kindskopfgroßen Wackersteine drohten, mir meine Gabel um die Ohren zu hauen. Es war eine Tortur vom Allerfeinsten. Nichts, absolut gar nichts konnte es mit diesen belgischen Pflastersteinen aufnehmen!
Karsten Migels sagt bei Eurosport immer so schön: „Schön den Druck auf der Kette behalten!“
Hahaha, das klingt so herrlich einfach. Hier? Fehlanzeige. Egal, wo ich fahre, es werden alle Knochen brutal durchgerüttelt, mein Helm hämmert auf den Schädel ein, alle Muskeln schlackern, es fühlt sich an wie ein Erdbeben, Richterskala 9,9. Mindestens.
Auch in der Mitte, wo sich die Steine leicht bauchig nach oben wölben, ist es eigentlich nicht fahrbar. Ich weiß gar nicht, wie ich den Lenker halten soll. Oberlenker? Unterlenker? Bremsgriff? Egal wie, ich habe einfach keine Kontrolle. Mein Rad springt unter mir unkontrolliert von links nach rechts und mein Hirn tanzt Pogo. Da hilft nur eins…Geschwindigkeit runter. Ich lasse also einfach rollen und versuche, nicht mit dem Rad in den tiefen Furchen stecken zu bleiben.
Mein neuer liebster Feind – Kopfsteinpflaster! Wie kann man so etwas nur mögen? Gerne machen? Immer wieder tun? Mir fällt wieder die Beschreibung vom Fremdenverkehrsverein ein: 59 Abschnitte in 72 Stunden…na dann mal los. Ich habe jetzt schon Blasen an den Händen. Aber es warten noch 58 Segmente!
Es wartet der Koppenberg.
Die spinnen – die Belgier!
Wir sind nun schon seit 5 Stunden unterwegs. Es ging rauf und runter und rauf und runter. Nicht wie in den Alpen über 10, 20, 30 km Anstieg, sondern immer schön kurz, so zwischen 500 m und 2 km. Aber jedes Mal richtig fies hoch. Gern mit 16,17,18% Steigung. Sehr gern auf Kopfsteinpflaster. So langsam, aber sicher haben wir unsere Körner verschossen. Und dann taucht er plötzlich auf: Der Koppenberg. Im Schnitt 11,6 % steil, am steilsten Stück 22 %.
Sieht ganz "süß" aus., oder? IST ES ABER NICHT!
Ich biege nach rechts ab, mache ein Foto und sehe mir an, was uns da erwartet. Eine Wand! Ein unglaublicher Anblick. Die Zufahrt zum Berg…Kopfsteinpflaster! Und wieder geht das Martyrium los denke ich mir und trete rein.
Die Hände fest um den Lenker gekrallt, versuche ich wie die Profis, auf der Außenseite – wo es auf Eurosport-Übertragungen immer so leicht aussieht – zu bleiben. Keine Chance, die Außenseite ist zugewuchert, also ab aufs Pflaster.
Bis zum Mittelstück ist alles fein. Während ich gewohnt langsam nach oben krieche, ächzt mein Tretlager, die Laufräder poltern laut über das Pflaster und meine Lunge kocht. Dann zieht es mächtig an. Ich fluche leise vor mich hin. 22 Prozent! Auf grobem Kopfsteinpflaster! Das ist die Hölle!
Ich zirkele, ich torkele um grobe Steinklötze, ich zerre am Lenker und versuche irgendwie, mein Rad und mich in Bewegung zu halten. Eine unglaubliche Plackerei. Kurz vorm völligen Stillstand. Schnappatmung setzt ein. Superslomo, mein Garmin geht in den Pause-Modus. „Fuck!“, presst es aus mir heraus, als ich das Steilstück erreiche, Zweiundzwanzig Prozent, ich sehe nur noch Steine vor mir, links überhole ich einen, der Absteigen muss, dann dreht bei mir das Hinterrad durch, mein Vorderrad verkeilt sich zwischen zwei Steinen – ich stehe still, das war´s, ausklicken, absteigen. Nun folgt der frustrierende Part. Ich schiebe. Die Cleats rutschen mir weg – scheiße, selbst laufen geht hier nicht! Schade, dass die Kamera keine 22% Steigung einfangen kann. Ich mache ein paar Fotos und schiebe etwas weiter hoch, wo ich mich bei „angenehmeren“ 10, 12% Steigung am Zaun abstützend wieder einklicke und den Koppenberg zu Ende fahre. Oben angekommen kann ich durch das Trikot hindurch mein Herz schlagen sehen. Alter Schwede (oder besser Belgier :-)), das war krass! Ich schaue zurück und schüttele den Kopf...
Irgendwann erreichen wir dann wieder Oudenaarde und damit das Ziel dieser ersten Etappe.
Ich falle fast vom Rad. Bin völlig fertig. So richtig kaputt.
Aus.
Vorbei.
Das war es.
Keinen Meter mache ich diesen Wahnsinn mehr mit – unfassbar, wie brutal das ist.
Und dann? Ihr ahnt es schon...
Natürlich war das nicht das Ende. Natürlich haben wir nicht aufgehört. Natürlich haben wir weiter gemacht. Die kompletten drei Tage durchgezogen. Alle 59 Segmente gerockt. Gelitten, gezweifelt, gehadert, geflucht, gelacht, gejubelt und ganz viel Spaß gehabt.
Wir haben es gemacht. 59 Segmente in 72 Stunden. 410 Kilometer, fast 6.000 Höhenmeter, zum Glück bei bestem Wetter. Nicht auszudenken, diese Strecke im Regen zu absolvieren. Die Flandernrundfahrt wird nicht umsonst als "Hölle von Flandern" umschrieben.
Wir fühlten uns als Helden. Helden, die diese krasse Strecke gemeistert haben, die sich Koppenberg, Oude Kwaremont, Paterberg & Co gestellt haben, und die es geschafft haben. Krasser ist wohl nur noch Paris-Roubaix.
Am Ende Blicke ich auf eine unvergesslich brutale, eine wahnsinnig schöne, extrem anstrengende und auf jeden Fall empfehlenswerte Zeit in Flandern zurück. Ein beeindruckendes Erlebnis, das nur noch getoppt wird, als wir im Museum in Oudenaarde unseren Stein in Empfang nehmen und in der Hall of Fame verewigt werden.
Jetzt platze ich vor Stolz!